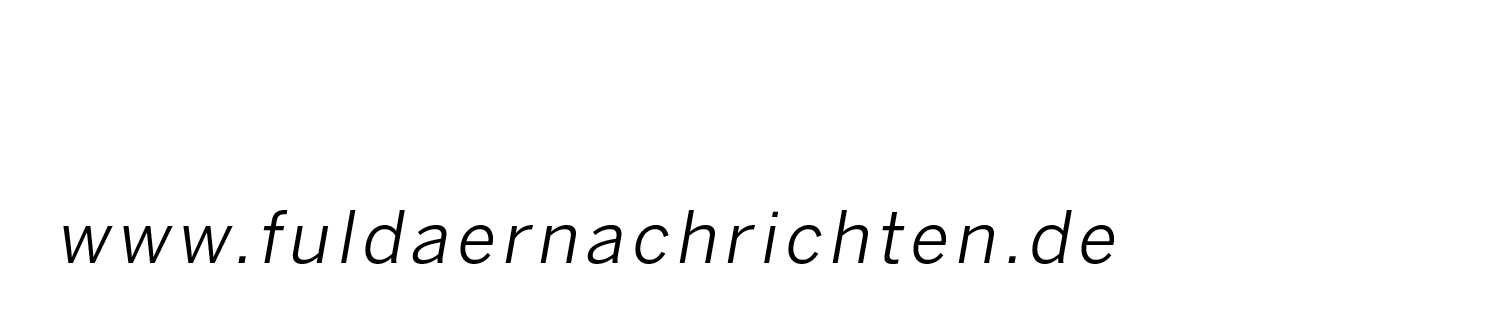Fulda. „Zum Leben zu wenig – zum Leben zu viel!?“ war das provokante Motto der diesjährigen Jahresauftaktveranstaltung der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) IMPULS 2011 in Fulda-Horas. Gastredner Dr. Franz Segbers, Professor für Sozialethik an der Universität Marburg, zeigte, von dem unveräußerbaren Menschenrecht auf Existenzsicherung ausgehend, einzelne Schritte aus der Krise der Arbeitsgesellschaft hin zu einem Grundeinkommen auf. Begonnen hatte die Veranstaltung mit einem vom stellvertretenden Diözesanpräses Pfr. Martin Lerg zelebrierten Gottesdienst.
Fulda. „Zum Leben zu wenig – zum Leben zu viel!?“ war das provokante Motto der diesjährigen Jahresauftaktveranstaltung der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) IMPULS 2011 in Fulda-Horas. Gastredner Dr. Franz Segbers, Professor für Sozialethik an der Universität Marburg, zeigte, von dem unveräußerbaren Menschenrecht auf Existenzsicherung ausgehend, einzelne Schritte aus der Krise der Arbeitsgesellschaft hin zu einem Grundeinkommen auf. Begonnen hatte die Veranstaltung mit einem vom stellvertretenden Diözesanpräses Pfr. Martin Lerg zelebrierten Gottesdienst.
Nach Sicht des Sozialethikers Prof. Dr. Segbers steckt die Arbeitsgesellschaft in einer tiefen Krise. Insbesondere die derzeitige Diskussion um die Hartz IV – Regelsätze machten dies deutlich. Auf der einen Seite sprechen manche Politiker beim derzeitigen Wirtschaftsaufschwung von Vollbeschäftigung, andererseits beziehen über fünfeinhalb Millionen Menschen Hartz IV. Nur die Hälfte davon werde jedoch in der offiziellen Arbeitslosenstatistik erfasst. Dies mache die Problematik deutlich, dass viele Menschen zwar Arbeit hätten, mit dem dafür erhaltenen Lohn aber kein ausreichendes Einkommen erzielen.
Noch deutlicher wird dies, wenn man feststelle, dass zwar 40 Millionen Menschen erwerbstätig seien, aber nur 22,5 Millionen eine sozialversicherungspflichtige Vollzeitstelle hätten. Beachtet werden müsse auch der Rückgang von Arbeitsplätzen im produktiven Bereich während gleichzeitig die Arbeit im Dienstleistungsbereich, insbesondere in der Pflege, zunähme, dafür aber die Finanzierung alles andere als sichergestellt sei.
Von dieser Situation ausgehend und gleichzeitig das Grundgesetz beachtend, das jedem Menschen ein individuell einklagbares soziales Grundrecht auf ein menschenwürdiges soziokulturelles Existenzminimum, abgeleitet aus der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, garantiert, werde deutlich dass die derzeit der Politik zur Verfügung stehenden Instrumente nicht ausreichen, die Probleme zu lösen. „Das Recht des Menschen auf Leben geht jeder Pflicht zu einer Gegenleistung voraus“ betont Segbers und weiter: „Hartz IV dagegen setzt Teilhabe an Erwerbsarbeit und Integration in die Gesellschaft gleich.“
Jede nicht sittenwidrige Arbeit werde ohne unter Lohngrenze als zumutbar erklärt. Die derzeitige Hartz IV Regelung, führe zu einer staatlich verordneten Unterversorgung und widerspricht nach Segbers Meinung somit den elementaren Menschenrechten. „ALG II und Sozialhilfe schützen weder vor Armut noch garantieren sie das soziokulturelle Existenzminimum“ betont der Sozialethiker.
Dem entgegenzuwirken mehren sich die Stimmen, die dem Arbeitszwang nach Hartz IV das Menschenrecht eines jeden Bürgers auf ein Grundeinkommen fordern. Dazu gehören nicht nur der Vorschlag des ehemaligen thüringischen Ministerpräsidenten Dieter Althaus für ein Bürgergeld, sondern auch das Modell der KAB auf ein bedingungsloses Grundeinkommen. Entscheidend sei dabei, dass der Begriff der Tätigkeit nicht nur an die Erwerbsarbeit gekoppelt sein dürfe, sondern auch an die Familien- und Pflegearbeit wie auch gemeinnützige Arbeit.
Diese derzeit in der Regel von Entlohnung unabhängige Leistungen sind für die Gesellschaft unerlässlich. Zivilgesellschaftliche Arbeit und Sorge- oder Familienarbeit, gleichberechtigt für Männer und Frauen, gekoppelt mit Erwerbsarbeit, braucht eine existenzsichernde ökonomische Basis begründet Segbers die Forderung nach einer Grundsicherung.
Mit der Forderung eines bedingungslosen Grundeinkommens müsse nicht ein absoluter Bruch mit dem bisherigen Sozialsystems einhergehen. Vielmehr seien Anknüpfungen wichtig, die den Sozialstaat in diese Richtung weiterentwickeln. Dazu zählte er drei Schritte auf. Auf die derzeitigen Sanktionsregeln bei Hartz IV. auf dem Hintergrund des Grundsatzes „Fordern und Fördern“ müsste zugunsten des Rechts auf ein unabdingbares Recht auf ein soziokulturelles Existenzminimum verzichtet werden.
Für Sorge- oder Carearbeit müsse ein temporäres Grundeinkommen eingeführt werden. Die dazu notwendigen Regelungen könnten sich am derzeitigen Betreuungs- und Elterngeld ausrichten. Eine Absage erteilte Segbers in diesem Zusammenhang dem Vorschlag von Familienministerin Schröder, eine gesetzliche Familienpflegezeit einzuführen. In dem Vorschlag bis zwei Jahre als Arbeitnehmer nur 50 % zu arbeiten und für diesen Zeitraum sowie im Anschluss für den selben Zeitraum nur 75 % des Arbeitsentgelds zu erhalten, sieht er eine Verschiebung der gesellschaftlichen Verantwortung in den privaten Bereich.
Eine Kindergrundsicherung in Höhe von 500 € im Monat für alle Kinder würde als erste Regelung dem Existenzminimum für Kinder gerecht werden, das bisher nur im Steuerrecht verankert ist. Diese vom Einkommen der Eltern unabhängige Leistung würde grundsätzlich gezahlt, während heute viele Leistungen für Kinder nur auf Antrag gezahlt werden, wobei nicht alle Anspruchsberechtigten alle möglichen zustehenden Leistungen beantragen. Nach aktuellen Berechnungen würde diese partielle Form der Grundsicherung für Kinder zwar die Gesellschaft monetär belasten, doch könne auf der anderen Seite die Kinderarmutsquote um vier Fünftel auf 3,3 Prozent gesenkt werden.
„Die Forderung nach einem Grundeinkommen ist die Antwort auf die Krise der Arbeitsgesellschaft. Sie ist mehr als eine sozialpolitische Forderung, sie will ein grundlegendes gesellschaftliches Problem lösen“ versuchte Segbers die Teilnehmer der Veranstaltung für seine Ideen zu gewinnen. Ziel sei es, für alle ein Leben in sozialer Sicherheit und Würde zu garantieren.
Schon in seiner Begrüßung hatte der Diözesanvorsitzende der KAB, Klaus Schmitt auf die Besonderheit des christlichen Menschenbildes, nach dem der Sozialverband sein Tun ausrichte, hingewiesen. „Der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen bezieht seinen Wert aus seinem Dasein und nicht aus seiner Leistungsfähigkeit“ führte er aus und warb bei den Gästen aus KAB Vereinen und anderen Verbänden und Gruppierungen dafür, sich mit der Thematik intensiv auseinanderzusetzen.
In einem Grußwort zeigte Oberbürgermeister Gerhard Möller das Spannungsfeld zwischen christlichem Anspruch und realer Politik auf. Politisches Handeln richte er an dem christlichen Anspruch aus, könne aber letztendlich in der pluralen Gesellschaft häufig nur zu Kompromissen führen. Die KAB forderte er auf, weiterhin ihr Streben für mehr Gerechtigkeit in die Gesellschaft hineinzutragen.
Auch der stellvertretende KAB Diözesanpräses Pfr. Martin Lerg hatte das Gerechtigkeitshandeln in den Mittelpunkt des einleitenden Gottesdienstes gestellt. So wie Gott unter den Menschen versuchte, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, so seien Christen heute in die Welt gestellt, in seinem Sinn tätig zu werden. Dies gelte insbesondere auch für die Mitglieder der KAB.
Das Referat des Sozialethikers Prof. Dr. Franz Segbers kann unter www.kab-fulda.de aus dem Internet heruntergeladen werden.