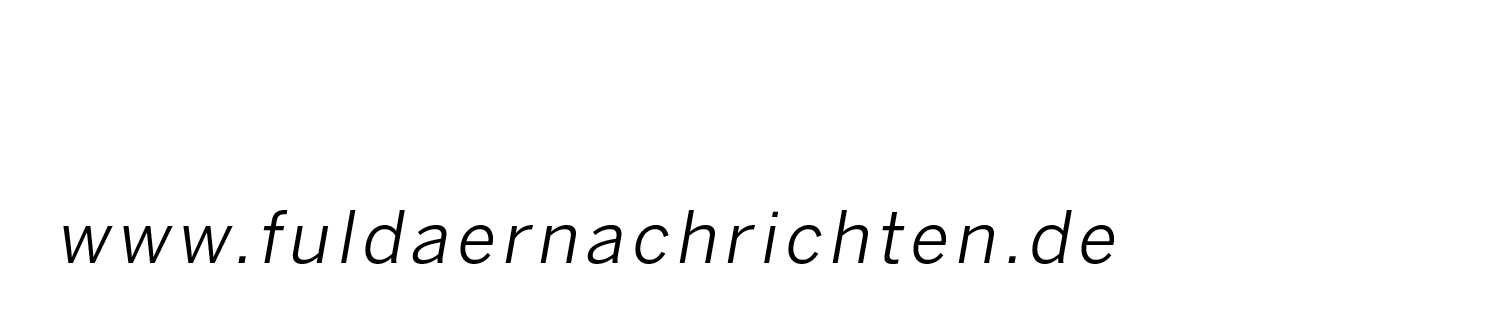Rhön. Das Interesse der Jäger und Forstämter, in Zukunft mehr Wild aus Rhöner Wäldern direkt in der Region zu vermarkten, ist groß. Das zeigte jetzt der 2. Workshop zum Thema „Rhönwild“ in Geisa. Auch an diesem nahmen wieder Vertreter aus Hessen, der Thüringer Rhön und aus Unterfranken teil. Unter ihnen besteht Einigkeit, dass die Vermarktung rhönweit koordiniert werden soll und in Zukunft sogar in ein Unternehmen münden könnte, das sich der Verarbeitung von Rhönwild bis hin zur Herstellung spezieller Produkte wie Wurst widmet. Das Projekt unter dem Titel „Analyse und Aufbau der Wertschöpfungskette Rhöner Wild“ ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Rhönforum e.V. und der Dachmarke Rhön und wird von Martina Klüber-Wibelitz vom Büro Antsanvia in Schleid gemanagt. Im ersten Workshop hatten die Interessenvertreter der Jäger, Forstämter und Jagdverbände die generellen Möglichkeiten ausgelotet, ob eine Steigerung des Wildabsatzes in der direkten Region überhaupt möglich ist.
Rhön. Das Interesse der Jäger und Forstämter, in Zukunft mehr Wild aus Rhöner Wäldern direkt in der Region zu vermarkten, ist groß. Das zeigte jetzt der 2. Workshop zum Thema „Rhönwild“ in Geisa. Auch an diesem nahmen wieder Vertreter aus Hessen, der Thüringer Rhön und aus Unterfranken teil. Unter ihnen besteht Einigkeit, dass die Vermarktung rhönweit koordiniert werden soll und in Zukunft sogar in ein Unternehmen münden könnte, das sich der Verarbeitung von Rhönwild bis hin zur Herstellung spezieller Produkte wie Wurst widmet. Das Projekt unter dem Titel „Analyse und Aufbau der Wertschöpfungskette Rhöner Wild“ ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Rhönforum e.V. und der Dachmarke Rhön und wird von Martina Klüber-Wibelitz vom Büro Antsanvia in Schleid gemanagt. Im ersten Workshop hatten die Interessenvertreter der Jäger, Forstämter und Jagdverbände die generellen Möglichkeiten ausgelotet, ob eine Steigerung des Wildabsatzes in der direkten Region überhaupt möglich ist.
Daher waren beim ersten Workshop auch die Vertreter der Gastronomie und Hotellerie mit eingeladen. Jetzt diskutierten Jäger, Vertreter der Forstämter sowie Schlachtbetriebe und Metzger untereinander, mit welchen Modellen das Ziel gelingen kann, mehr einheimisches Wild direkt in der Region, aber auch überregional zu vermarkten. Der Grund für die Vermarktungsprobleme wird vor allem in der fehlenden Zusammenfassung des in der Rhön zerstreuten Angebotes zu großen Partien und mit einheitlicher Qualität gesehen. Wenn das gelingen würde, so Klüber-Wibelitz, könnten neben der Gastronomie auch Großabnehmer im Handelsbereich gewonnen und damit eine echte Wertschöpfung in der Rhön erzielt werden. Die Akteure sind in der Rhön weit verstreut, so dass es einer geschickten Koordination und Professionalisierung bedarf.
Barbara Vay, Geschäftsführerin der Dachmarke Rhön GmbH, stellte drei Kooperationsmodelle vor, die im Anschluss diskutiert wurden. Sie bot an, in einer ersten Stufe innerhalb der Dachmarke Rhön eine neue Branche für Rhöner Wild zu eröffnen und für diese entsprechende Kriterien zu erarbeiten. Somit könnten die Jäger und Forstämter das Netzwerk der Gastronomen nutzen, die bereits Partnerbetrieb der Dachmarke Rhön sind. Mit dem Qualitätssiegel, das dann für Rhöner Wild verliehen werde, sei die Werbung nach außen hin möglich. Innerhalb von zwei bis drei Monaten, erklärte Barbara Vay, sei die Verabschiedung der Qualitätskriterien für Rhöner Wild machbar.
Ein zweites mögliches Geschäftsmodell könnten dezentrale Zerlegeservice-Betriebe unter Einbeziehung aller vorhandenen Strukturen sein. Dies würde die Kooperation zwischen Jägern und Metzgern betreffen und könnte in ein gemeinsames Projekt zwischen Jägerschaft und Forst, den Metzgerinnungen und der Dachmarke Rhön münden. Das Zerlegeservice-Modell müsse jedoch EU-zertifiziert für die Wildbretverarbeitung sein. Bis zum Funktionieren eines solchen Zusammenschlusses potentieller Partner würde es nach Schätzung von Barbara Vay rund ein halbes Jahr dauern.
Die langfristigste und zugleich anspruchvollste Lösung für die Zukunft sahen die meisten der anwesenden Jäger und Vertreter von Forstämtern in der Gründung einer Erzeugergemeinschaft und deren Überführung in eine rechtsfähige Organisation wie beispielsweise eine Genossenschaft. Dabei wird an eine Verarbeitungszentrale gedacht, die eine eigene Marke für Rhöner Wild auf den Markt bringt, eine gebündelte Vermarktung für den regionalen und überregionalen Handel und die Gastronomie organisiert und Premiumprodukte wie Wurst und Fertiggerichte produziert. „Diejenigen, die sich an einem solchen Geschäftsmodell beteiligen, müssen unternehmerisches Denken und Handeln mitbringen“, betonte Barbara Vay. Allerdings werde es mindestens ein Jahr dauern, bis ein solches Unternehmen starten könne. Das Geschäftsmodell müsse zunächst gründlich recherchiert, mögliche Fördermittel eingeworben und ein Businessplan erarbeitet werden.
Der Forstamtsleiter des Thüringer Forstamts Kaltennordheim, Matthias Marbach, sagte, dass zunächst in Erfahrung gebracht werden müsse, wie groß die zu vermarktende Mindestmenge sein muss, wenn eine solche Partnerschaft aufgebaut werde. Außerdem benötige man dann Partner, die auch in der Lage dazu seien, verbindlich zu liefern. Daher sei es ratsam, mit den Kreisjägerschaften oder Forstämtern zusammen zu arbeiten.
Der 2. und vorerst letzte Workshop zum Thema „Rhönwild“ beschäftigte sich auch mit der Auslegung von Hygienerichtlinien wie der Ausstattung der Kühlräume und dem Einhalten einer lückenlosen Kühlkette. Die Leitung einer entsprechenden Arbeitsgruppe hatte hierbei Martina Klüber-Wibelitz übernommen. „Das EU-Hygienerecht ist keine Gängelei, sondern in erster Linie Sicherheit. Es geht dabei um die Rückverfolgbarkeit“, sagte ein Unternehmer aus Hessen, der einen Zerlegebetrieb für Wild führt. Hannelore Rundell, die stellvertretende Geschäftsführerin der Dachmarke Rhön, hatte sich in einer weiteren Arbeitsgruppe bereits mit ersten Eckpunkten für Qualitätskriterien beschäftigt, die an die Vermarktung von Rhöner Wild unter der Dachmarke Rhön geknüpft sind. „In diese Vermarktungskette kann nur das beste Wildfleisch einfließen“, so ihr Fazit.