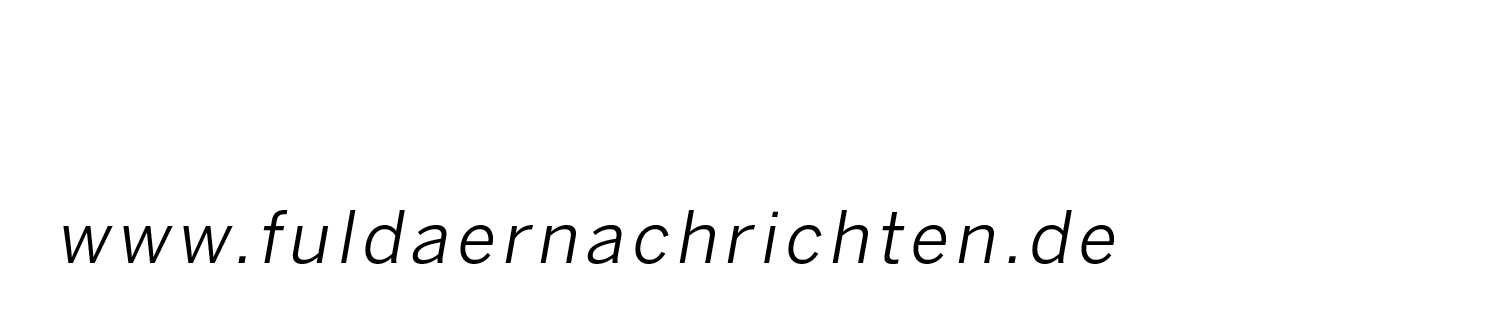Wildflecken/Poppenroth. Von Vacha in der thüringischen Rhön bis Hammelburg waren die Teilnehmer angereist, um sich bei der 12. Hauptnaturschutztagung des Rhönklub e.V. in Poppenroth fortzubilden. Hauptnaturschutzwart Heinrich Heß, Hünfeld, und auch Präsidentin Regina Rinke, Wildflecken, konnten ihre Freude über die stattliche Zahl von 65 Teilnehmern nicht verbergen.
Wildflecken/Poppenroth. Von Vacha in der thüringischen Rhön bis Hammelburg waren die Teilnehmer angereist, um sich bei der 12. Hauptnaturschutztagung des Rhönklub e.V. in Poppenroth fortzubilden. Hauptnaturschutzwart Heinrich Heß, Hünfeld, und auch Präsidentin Regina Rinke, Wildflecken, konnten ihre Freude über die stattliche Zahl von 65 Teilnehmern nicht verbergen.
Namhafte Referenten
Aus allen 3 Bundesländern hatten namhafte Referenten sich pünktlich eingefunden. Über „Wald- und Forstwirtschaft im Spannungsfeld unterschiedlicher gesellschaftlicher Interessen“ sprach zu Beginn der Geschäftsführer von Hessen-Forst, Michael Gerst. Für seinen Betrieb stehe der wirtschaftliche Nutzen des Waldes nicht im Vordergrund. Man müsse sich auch mir der Forschung auseinandersetzen. Auch die Naturschutzgebiete und ein Nationalpark würden von Hessen-Forst betreut. Es gäbe viele unterschiedliche Interessen am Wald – dies sei ein Spannungsfeld. Er zitierte: Ein Egoist sei ein Mensch, der für sich selbst mehr Interesse zeigt als für andere! Das Ergebnis der Konferenz von Rio vor fast 20 Jahren sei die Aussage, dass der Wald so zu bewirtschaften sei, dass er für die Zukunft erhalten bleibt. 1998 habe es dann in Lissabon geheißen: Die Waldwirtschaft müsse nachhaltig sein – also, es dürfe aus dem Wald nicht mehr geerntet werden als nachwachse! In Hessen seien 41 % der Landesfläche Wald. Die Bevölkerungsdichte liege bei 264 Einwohnern pro Quadratkilometer. Diese Menschen suchten nach Erholung im Wald. Das heiße. Radler, Mountainbiker, Reiter und Wanderer ziehe es an den Wochenenden hinaus in den Wald. Das freie Betretungsrecht des Waldes sei gesetzlich verankert. Die Besucher erwarten einen ästhetischen Wald, gute Wege, Parkplätze, Brücken, Geländer und bei Unfällen dann auch noch Schadensersatz. Zum Schluss forderte der Redner, man müsse Regeln im Umgang miteinander beachten, sich also so im Wald, in der freien Natur verhalten, dass die Interessen des Eigentümers gewahrt werden.
Bayerische Staatsforsten
Der Naturschutzbeauftragte der Bayerischen Staatsforsten, Axel Reichert, stellte das Naturschutzprogramm seiner Institution vor. Er nannte den Schutz der Wälder, der Biotopbäume, der Totholzbestände, der Feuchtstandorte, der Trockengebiete, der Auwälder und der Moore. Es gäbe z.B. in Bayern 1% an über 300 Jahre alten Eichen. Diese würden vollkommen aus der Wirtschaft genommen. Für sie gäbe es Hiebruhe! Rote-Liste-Arten würden besonders geschützt. Bei Totholz gäbe es natürliche Zerfallsphasen, wobei die Lebensgemeinschaften dort niemals augenscheinlich wahrgenommen werden könnten. Alten Bäumen gelte große Aufmerksamkeit. Der Referent konnte mit fantastischen Bildern seltener Arten aufwarten. Er bot an, gemeinsame Veranstaltungen mit den Wandervereinen durchführen zu können.
ThüringenForst
Albrecht Glaser aus Thüringen hatte das Thema „Zielsetzungen und betriebswirtschaftliche Sachzwänge bei der Bewirtschaftung der Wälder in Thüringen“ gewählt. Der Wald müsse vielfältigen Ansprüchen gerecht werden: Arbeitsraum, Rohstoffquelle, Lebensraum, Schutzraum, Regenerationsraum und Erholungsraum. Die Erholungsfunktionen seien zu optimieren! Schließlich stelle der Tourismus einen Wirtschaftsfaktor im ländlichen Raum dar. Dazu seien tragfähige und ökologisch sinnvolle Konzepte zu erarbeiten. Es gäbe in Thüringen schon insgesamt 17.000 km Wanderwege, aber auch 12.000 km Reitwege sowie fast 7.000 km Radwege. Dafür sei es notwendig, die Eigentumsverhältnisse abzuklären, Gestattungsverträge abzuschließen, die Verkehrssicherheit jährlich zu überprüfen und schließlich den Aufwand für diese Pflege und Unterhaltung zu ermitteln.
Bad Neustadt/Saale
Vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten war Wilhelm Schmalen aus Bad Neustadt/Saale angereist. Er hatte sich den Kommunalwald mit seinen Sachzwängen und Zielsetzungen als Thema gewählt. Die Gemeinde Burkardroth mit ihren 12 Ortsteilen und einer Waldfläche von 2083 ha war als Paradebeispiel gewählt. Die Höhenöage reiche von 200 m bis 800 m üNN. Die durchschnittliche Temperatur läge bei 8 Grad Celsius. Das Klima sei subatlantisch. 52 % wären mit Kiefern bestanden, etwa 16 % mit Fichten, die Buche käme nur auf 13% und die Eiche nur auf11 % . Für den Kommunalwald gelten die gleichen Ziele wie für den Staatswald. Er diene dem Gemeinwohl, der Naturschutz und die Wasserwirtschaft seien zu berücksichtigen. Die biologische Vielfalt sowie die Erholungsfunktion, aber auch die Holzerzeugung lägen im Blickfeld. Forstwirtschaftliche Pläne seien für 20 Jahre zu erstellen. Da in der gemeinde der Sandboden vorherrsche, gäbe es größere Kiefernbestände. Das Holz wachse langsam, sei dadurch aber besonders wertvoll. Da die Fichte oftmals vom Schneebruch betroffen sei, plane man einen Waldumbau! Die Buche sei die natürliche Baumart der Rhön. Deshalb sie das Ziel, Laubmischwälder mit einem großen Artenreichtum anzulegen. Das Holz der Buche sei ein wertvolles Brennholz. Als Sachzwänge nannte der Referent die Schutzgebietsforderungen, die FFH-Gebiete, den Wegebau, die Wanderwege und die Verkehrssicherungspflicht. Der Bildungsauftrag würde in Burkardroth sehr gut umgesetzt.
Beispiel Burkardroth
Bürgermeister Waldemar Bug aus Burkardroth spannte den Bogen vom Gestern über das heute zum Morgen. Vom herrschaftlichen Wald der kirchlichen und weltlichen Herrscher, die den Wald vorzugsweise zur Jagd nutzten über das Heute, in dem dies gottlob anders sei wagte er den Blick in die Zukunft, die allerdings keiner kenne. Ziel müsse vorrangig eine nachhaltige Waldbewirtschaftung sein. Dazu bedürfe es eigentlich nur eines gesunden Menschenverstandes. Im Mittelalter sei das Holz vorwiegend als Baumaterial eingesetzt worden, aber auch für industrielle Zwecke wie Glasbläsereien und Eisenschmelzen. Der Wald sei gerodet worden, deshalb die vielen Ortsnamen, die auf roth endeten. Das Holz sei dann von Kohle Erdöl, Gas als Energiespender abgelöst worden. Auch andere Baumaterialien seien auf den Markt gekommen wie Beton, Sein, Aluminium und Kunststoff. Fossile Brennstoffe jedoch seien endlich, sie gingen einmal zur Neige- da die Industrie nachwachsende Rohstoffe verbrauche, müsse ein Umdenken erfolgen. Wind, Wasser und Sonne nähmen immer mehr Platz in den Köpfen der verantwortlichen Politiker ein. Für die Zukunft forderte er eine Waldflurbereinigung wie einstmals bei der Landwirtschaft. Manche Parzellen der Privatwälder seien viel zu klein, um diese sinnvoll zu bewirtschaften. Es müssten Forstbetriebsgemeinschaften gegründet werden, welche die Lösung der Konfliktpotentiale wie z.B. die Verkehrssicherungspflicht oder das Problem der Kernzonen aufarbeiten.
Privatwaldbesitzer
Über die Probleme der Privatwaldbesitzer berichtete Matthias Becker vom Hessischen Waldbesitzerverband. Der Büdinger Wald mit 100 Quadratkilometern Fläche sei der größte Wald in Privatbesitz in Hessen. Dort gäbe es 800 km Wege, davon 450 befahrbar. Drei Forstreviere mit 14 Mitarbeitern nähmen sich der Fläche an. Auch hier gelten die Ziele Schutz, Nutz und Erholung. Der Schutz koste, der Nutz bringe ein und die Erholung koste für Technik zum Entfernen dürrer Äste usw. pro Tag 300 €. Mit großem Engagement referierte becker über die Ansprüche der Waldbesucher. Sie sähen keinen Unterschied zwischen Staatswald und Privatbesitz. Es würde eine gute Wegequalität erwartet mit Bänken und überdachten Sitzgelegenheiten, mit weggeräumten Ästen usw. Ein sehr großes Problem stelle die Verkehrssicherungspflicht dar. Bei einem Sturz werde nicht nachgefragt, ob das richtige Schuhwerk getragen worden sei, man sähe die Schuld beim Grundbesitzer. Um Wanderwege in einem Privatwald zu kennzeichnen sei immer erst der Kontakt zum Eigentümer zu suchen. Eine Genehmigung sei einzuholen und evtl. ein Gestattungsvertrag zu unterzeichnen. An die Politik wandte sich der Redner mit dem Satz: Die Eigentumsrechte müssten gestärkt werden.
Podiumsdiskussion
Matthias Marbach (Thür.), Wolfram Zeller (Bay) und Adalbert Fischer (Hess. stellten sich den Fragen der Teilnehmer. Die 12.000 km Reitwege waren den Rhönklublern aus Thüringen eine Nummer zu groß. Es habe schon Unfälle mit Reitern gegeben. Präsidentin Rinke klärte dahingehend auf, dass die Mitglieder des Rhönklubs den Wald niemals in einem unsauberen Zustand verlassen würden. Dafür verbürge sie sich.
Exkursion am Nachmittag
Wolfram Zeller hatte sich verschiedene „Waldbilder“ ausgedacht, die er den Teilnehmrn zeigen wollte. Dazu fuhren sie zum „Tatoret“ von vor 5 Jahren, wo damals vom Rhönklub und Alpenverein ca. 9.000 Buchenssetzlinge gepflanzt worden waren. Das Jahr nach der Pflanzung sei sehr trocken gewesen und viele Bäumchen hätten dies nicht überstanden. Auch ein Sturm habe großen Schaden angerichtet. Das Areal sei eine „Katastrophenfläche“, so Wolfram Zeller. Dennoch wurden schon recht ansehnliche Exemplare der Buchen entdeckt. Sie hatten aber noch nicht ausgetrieben. Die nächste Station war technischer Art. Hier war Herr Kohl mit seiner Harvester im Einsatz. Diese Maschine kostet ca. 400.000 €. Die Arbeitsweise dieses Monstrums beeindruckte vor allem die Männer. Sie war dabei, sog. Rückegassen zu schlagen. Diese werden im Abstand von 30 m durch den Wald angelegt zum späteren Abtransport des Holzes. Schlusspinkt der Exkursion war ein Waldstücj mit 130 Jahre altem Bestand. Hier konnte die natürliche „Nachzucht“ von Jungholz besichtigt werden. Keiner der Bäumchen war gepflanzt worden. 6 Jahre alte Buchen standen neben denen, die schon 130 Jahre an diesem Standort wachsen und herrliche schlanke Stämme hatten. Regina Rinke dankte zum Abschluss allen, die zum Gelingen dieser vom ZV Garitz hervorragend vorbereiteten Tagung beigetragen hatten.