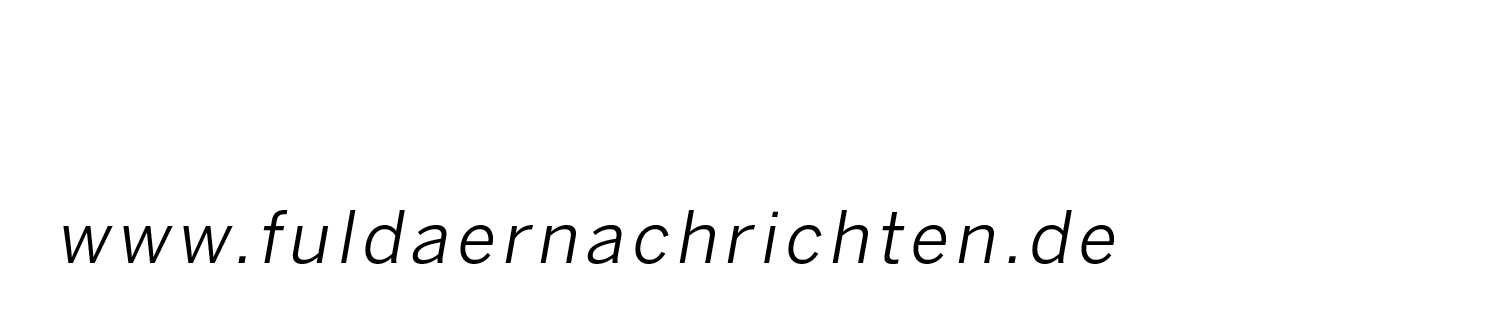Fulda/Rhön. Naturschutz und Landwirtschaft lassen sich im Biosphärenreservat Rhön gut miteinander in Einklang bringen. Zu diesem Ergebnis kamen die Verantwortlichen des Grünlandprojekts des Biosphärenreservats Rhön. Dieses wird seit 2005 von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert und von den Kreisbauernverbänden Rhön-Grabfeld und Fulda-Hünfeld unterstützt. Im September läuft das Forschungsprojekt aus. Die Ergebnisse werden bis zum 7. August in einer Ausstellung im Kundenzentrum der ÜWAG in Fulda vorgestellt.
Fulda/Rhön. Naturschutz und Landwirtschaft lassen sich im Biosphärenreservat Rhön gut miteinander in Einklang bringen. Zu diesem Ergebnis kamen die Verantwortlichen des Grünlandprojekts des Biosphärenreservats Rhön. Dieses wird seit 2005 von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert und von den Kreisbauernverbänden Rhön-Grabfeld und Fulda-Hünfeld unterstützt. Im September läuft das Forschungsprojekt aus. Die Ergebnisse werden bis zum 7. August in einer Ausstellung im Kundenzentrum der ÜWAG in Fulda vorgestellt.
Ökologische Bewirtschaftung der Flächen ist gut für die Artenvielfalt
Frank Weinmann, stellvertretender Bereichsleiter Energiewirtschaft bei der ÜWAG, fand, dass ein Naturschutzprojekt gut zu dem regionalen Stromversorgungsunternehmen passe. Fuldas Landrat Bernd Woide erinnerte daran, dass die Rhön immer Kulturlandschaft gewesen sei. Der Vorsitzende des Vereins Natur- und Lebensraum Rhön und Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Fulda-Hünfeld, Dr. Hubert Beier, stellte die landwirtschaftlichen Strukturen der Rhön vor. So würden zwölf Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe in der Rhön ökologisch bewirtschaftet, ein im bundesweiten Vergleich sehr hoher Wert. Im Hochland der Rhön seien fast ausschließlich Ökobauern aktiv.
„Naturschutz und das Land der offenen Fernen benötigen eine profitable Landwirtschaft“, betonte in seinem Referat Prof. Dr. Eckhard Jedicke. Er ist Projektleiter des seit 2005 laufenden Grünlandprojekts im Biosphärenreservat Rhön, bei dem es in erster Linie um die großflächige, extensive und ganzjährige Beweidung geht. Ziel soll eine dauerhafte landwirtschaftliche Nutzung der kargen Hochflächen der Rhön bei maximalem Nutzen sein.
64 Betriebe mit 38 Modellweiden
Jedicke verwies anlässlich der Ausstellungseröffnung auf ein erstes Ergebnis des Projekts. So erzielten ökologisch bewirtschaftete Weidegebiete in diesem Gebiet deutlich bessere Erträge als konventionell bewirtschaftete. An dem Projekt haben sich 64 Betriebe mit 38 Modellweiden, davon 23 in Bayern, zwölf in Hessen und drei in Thüringen, beteiligt. Wichtig sei eine ausreichend große Weidefläche gewesen. So wurden kleinere Grundstücke in Weidegemeinschaften zusammengeführt.
Insgesamt wurden 867,5 Hektar modellhaft bewirtschaftet. Die Flächen konzentrierten sich auf dem Gebiet der Langen Rhön in Hessen und Bayern. So wurden bei der Weidegemeinschaft Steinkopf bei Wüstensachsen alte Parzellenzäune beseitigt; lediglich die Wanderwege wurden durch Zäune vor den Rindern geschützt. Es wurden Unterstände gebaut und die Winterbeweidung eingeführt. Dann wurden die auf den Weideflächen vorkommenden Arten kartiert. Dabei zeigte sich eine große ökologische Vielfalt auf den Weiden. Die vom Aussterben bedrohte Drüsige Fetthenne zum Beispiel gedeiht dort gut, und auch die Mistkäfer, Lieblingsspeise von Fledermäusen und anderen bedrohten Arten, finden auf den Flächen ideale Bedingungen. Auch blühen Blumen auf den Weiden oft länger als auf den artenreicheren Wiesen, die nach der Silo- oder Heumahd bis auf schmale Säume blütenfrei sind. So finden Insekten dort immer Nahrung.
Perfekt angepasst
Die meisten Landwirte, die an dem Projekt beteiligt waren, wollen nach Jedickes Angaben in dieser Form weiter arbeiten. Neben der Schaffung zusammenhängender Weide- und Mahdflächen nannte der Wissenschaftler eine gute Vermarktung als Voraussetzung für ein erfolgreiches ökologisches Wirtschaften. Vorgestellt wurde während der Ausstellungseröffnung daher die gute Zusammenarbeit zwischen der Handelskette „tegut… gute Lebensmittel“ aus Fulda und dem Verein Rhöner Biosphärenrind e.V., dessen Landwirte Fleckvieh-Mutterkuhherden halten und Rindfleisch in Bio-Qualität erzeugen sowie die Produktkette „Rhönschdegge“ aus dem Fleisch des „Gelben Frankenviehs“, die von der Metzgerei Werner Söder im unterfränkischen Sandberg hergestellt wird. Ohne das Gelbe Frankenvieh war das bäuerliche Leben in der Rhöner Landschaft früher undenkbar. Als klassisches Dreinutzungsrind wurde das Gelbe Frankenvieh als Arbeitstier, Milch- und Fleischlieferant genutzt und geschätzt. Doch die Landwirtschaft wurde intensiver, züchtete spezialisierte Rassen und verdrängte damit die Mehrnutzungsrassen. Dabei sind diese Rinder robuster und anspruchsloser als viele ihrer Artgenossen und an die Hochweiden der Rhön bestens angepasst.
Heute wird das Gelbvieh aufgrund seiner vielen Vorzüge und des schmackhaften Fleisches wieder geschätzt. Der Landschaftspflegeverband Rhön-Grabfeld und das Grünlandprojekt im Biosphärenreservat Rhön unterstützen die Landwirte, um die Haltung rentabel zu machen und damit den Erhalt dieser regionalen Rasse zu sichern. Die „Ur-Einwohner von Unterfranken“ dürfen wieder auf ökologisch wichtigen und schützenswerten Wiesen weiden und helfen damit, die Artenvielfalt des Grünlands zu erhalten. Im Landkreis Fulda wird das Projekt nach einer Entscheidung im Kreistag durch die Fachdienste Landwirtschaft und Natur und Landschaft fortgeführt.
Die Ausstellung zum Grünlandprojekt, die durch die Wanderausstellung „Ökologischer Landbau“ ergänzt wird, ist zu den Öffnungszeiten des ÜWAG-Kundencenters in der Bahnhofstraße 2 in Fulda montags bis freitags von 9 bis 19 und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Sie läuft noch bis zum 7. August.