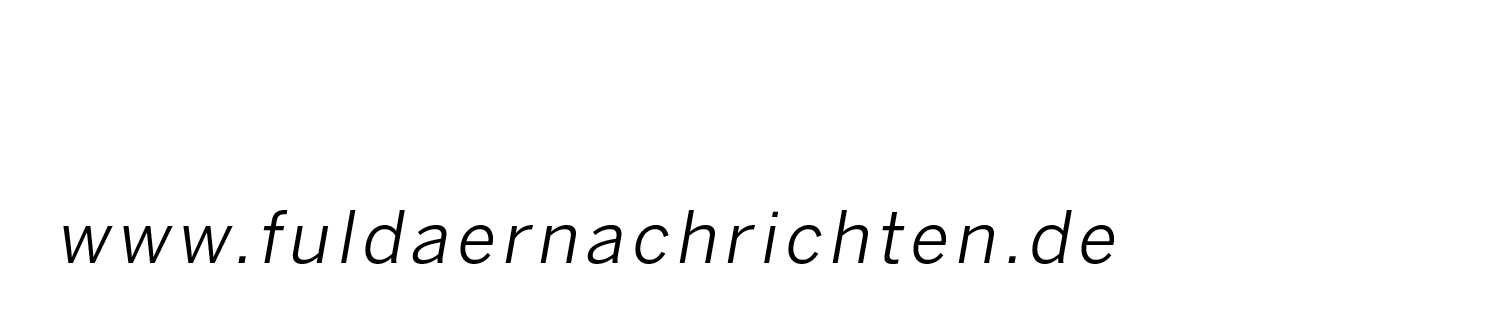Fulda (bpf). „Aus dem Glauben an Gott, den Vater aller Menschen, folgt, daß es zwischen den Menschen eine Grundsolidarität gibt. Unterschiede von Rasse, Klasse und Stand, die Zugehörigkeit zu einer anderen Konfession oder Religion, eine andere Meinung oder Überzeugung zu haben – all das zerstört diese fundamentale Gemeinsamkeit nicht.“ Dies hob Weihbischof Prof. Dr. Karlheinz Diez am Samstagvormittag im Fuldaer Dom hervor.
In seiner Predigt zum Hochfest Allerheiligen stellte der Weihbischof heraus, daß auch der andersdenkende Mitmensch von Gott angenommen sei. Umgekehrt tue auch die Erfahrung gut, von der Grundsolidarität der Menschen neben sich getragen zu werden. Leider gebe es auch gegenteilige Erfahrungen: Vorurteile, Ressentiments, die Suche nach Sündenböcken oder die Angst vor dem Fremden. „Selbst unter Christenmenschen werden sehr schnell negative Etiketten verteilt, etwa wenn es um grundsätzliche Fragen geht und entgegengesetzte Meinungen aufeinanderprallen“, gab Diez zu bedenken. „Wir sollen und müssen eigene Überzeugungen auch aussprechen. Aber das Gesicht darf sich beim Bezeugen der Wahrheit nicht verzerren.“ Das Bekennen dürfe nicht in Fanatismus umschlagen und der Austausch von Argumenten und Erfahrungen nicht durch Beschimpfungen und Verdächtigungen ersetzt werden. Am Hochfest Allerheiligen bekomme der christliche Glaube in den ungezählten Heiligen des Alltags ein Gesicht, „in denen das Antlitz Gottes aufleuchtet“.
Mimik und Gestik sind entscheidend
Zu Beginn seiner Ansprache erinnerte sich Diez an den Weltjugendtag in Sydney mit den vielen fröhlichen und freundlichen Gesichtern der Menschen. „Das menschliche Gesicht wird gerne als die kleinste Bühne der Welt bezeichnet; wir spüren schon bei der Wahrnehmung des Gesichtes, ob einer gut oder schlecht drauf ist.“ In den Augen erkenne man Müdigkeit, Wachheit, Gesundheit und Krankheit oder auch den Alkoholkonsum. „Im Antlitz verleiblichen sich Empfindungen wie Traurigkeit, Bitterkeit, Verhärmtheit oder auch Zuversicht, Fröhlichkeit und Gelassenheit.“ Im Gesicht drücke sich die unverwechselbare Identität bzw. die „Innenseite der Seele“ aus. Andererseits könne es auch verletzend sein, wenn jemand wiewohl körperlich präsent mit den Gedanken ganz woanders sei. Mit Blicken und mit der Gestik des Gesichtes könnten auch Kälte, Gleichgültigkeit und Verachtung signalisiert werden. Blicke könnten auch kontrollieren, überwachen, fixieren und lähmen.
„Die Seligpreisungen spiegeln das Antlitz Jesu und seine Liebe“ heiße es im Weltkatechismus der Katholischen Kirche, fuhr der Weihbischof fort. „Wir haben von Jesus kein authentisches Bild, kein Foto, keine Filmaufnahmen, keine handschriftlichen Dokumente, keine Unterschrift, keinen genetischen Code, aber: Die Seligpreisungen spiegeln das Antlitz, das Gesicht, die Identität Jesu, sie stehen im Herzen der Predigt Jesu.“ Dieses Antlitz Jesu vermittle, wer Gott für die Menschen sei. Jesu Blick gehe in die Tiefe und vermittle Würde, Zuwendung, Leben und Hoffnung. In Jesu Seligpreisungen schreibe Gott das „Hoheitszeichen seiner Liebe und Würde“ auf die Stirn eines jeden Menschen, auch des Freundes und Feindes, des Armen und Geringen. Wolle man von sich selbst, aber auch von anderen gering und verächtlich denken, würde man Gott selbst verachten und ihn geringschätzen.
Den Alltag besonders machen
„Wenn die dunkelste Zeit des Jahres beginnt, scheint an einem Tag in der Liturgie der Kirche das Zeugnis der Heiligen so hell in manchen Schatten unseres Alltags, daß sich neue Wege abzeichnen“, betonte Weihbischof Diez zur Bedeutung von Allerheiligen. Das Hochfest am ersten Tag des Novembermonats gebe der Verkündigung über die letzten Dinge in den letzten Tagen des alten Kirchenjahres eine helle Anschaulichkeit. „Im Alltag des Lebens das Fest des Glaubens entdecken zu können – seinen Trost, seine Freude, seinen Frieden, das unbegreifliche Glück einer Stimmigkeit und Erfüllung der eigenen Berufung sowie die Bestimmung der Lebensgeschichte – , macht die Persönlichkeit von Heiligen so interessant und attraktiv.“ In den scheinbaren Widerständen und Grenzen ihrer Biographien bezeugten sie die tiefere und oft verborgene Wirklichkeit der Lebensgeschichte aller. „Das Hochfest Allerheiligen meint die Niedrigen, die Kleinen, die an einer Stelle ihres Lebens entdeckt haben, daß Gott sie ganz persönlich meint und im Unscheinbaren anknüpft.“
Madeleine Delbrêl, die im säkularisierten Frankreich des 20. Jahrhunderts die Mystik des Alltags aufzuspüren versuchte, umschrieb ein Kapitel ihres geistlichen Nachlasses: „Wir Leute von der Straße“. Gott nehme laut Diez Wohnung im „Gewöhnlichen“, wie Madeleine Delbrêl es nenne. Die Heiligen hätten sehr oft so ein „gewöhnliches“ Leben, das aber auch ein Leben in Höhen und Tiefen gewesen sei, auf „außergewöhnliche“ Weise gelebt, im großen Vertrauen auf Gott. „Alle, derer wir an diesem Festtag gedenken, ob sie nun mit Namen in den Heiligenlisten des kirchlichen Kalenders stehen oder ob sie zu der großen Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen, die niemand zählen kann, gehören, waren sich der Vorläufigkeit dieses Lebens bewußt.“ Die Heiligen hätten eine „höhere Lebensqualität“ gesucht, die sich nicht im Essen und Trinken, in Macht und Geld erschöpft habe. Die eigenen Verwundungen in die Wunden des Herrn hineinzutauchen sei der wesentlichste Grundzug einer „Spiritualität der Heiligkeit“. Heiligenverehrung sei Ausdruck der Solidarität zwischen den in Gott Vollendeten und denen, die als „Pilger“ unterwegs seien, zu denen „auch wir noch gehören“. In der Begegnung mit den Heiligen gelte es, die eigene Gottebenbildlichkeit je neu zu bedenken und zu realisieren. Die Heiligen hätten ein Gespür, daß die Liebe die Sprache des Himmels sei und daß der Sinn des irdischen Daseins darin liege, diese Sprache zu erlernen.