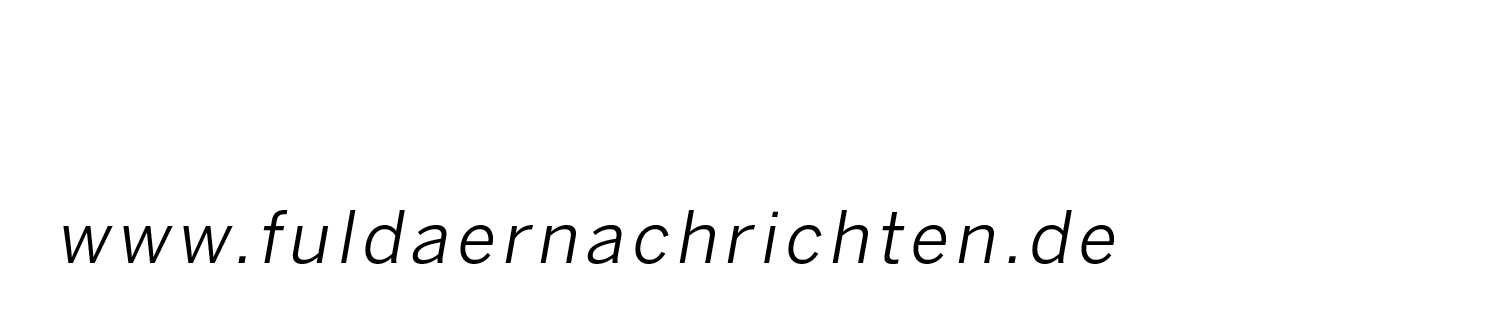Rotes Moor. Die schaurige, unheimliche und zugleich geheimnisvolle Atmosphäre der Moore hat schon immer eine faszinierende Wirkung auf den Menschen ausgeübt. Dies gilt auch für das Rote Moor, das sich auf hessischer Seite im Kernbereich des Biosphärenreservats Rhön an der Bundesstraße 278 von Wüstensachsen nach Bischofsheim befindet und zu jeder Zeit einen Besuch wert ist. Es stellt zudem das größte Moor Hessens dar.
Rotes Moor. Die schaurige, unheimliche und zugleich geheimnisvolle Atmosphäre der Moore hat schon immer eine faszinierende Wirkung auf den Menschen ausgeübt. Dies gilt auch für das Rote Moor, das sich auf hessischer Seite im Kernbereich des Biosphärenreservats Rhön an der Bundesstraße 278 von Wüstensachsen nach Bischofsheim befindet und zu jeder Zeit einen Besuch wert ist. Es stellt zudem das größte Moor Hessens dar.
Bereits während der letzten Eiszeit vor 13.000 Jahren begann sich das ursprünglich etwa 50 Hektar große Rote Moor zu entwickeln. In einer Höhe von etwa 720 bis 840 Meter liegt es im Plateaubereich der Hohen Rhön in einer weiten, flachen Hangmulde, in der sich zu Beginn der Moorbildung reichlich schüttende Schichtquellen sammelten. Wegen einer nur mäßigen Verdunstung im niederschlagsreichen und relativ kühlen Klima der Hochrhön sowie den schwer durchlässigen tonigen Ablagerungen als Untergrund konnte dieses Moor entstehen. Dabei hat sich die Oberfläche der für die Torfbildung hauptsächlich verantwortlichen Torfmoose immer höher verlagert. Wachsen die Torfmoospolster dann zunehmend über den Grundwasserspiegel hinaus und werden unabhängig von der Nährstoffzufuhr des mineralischen Bodens, geht das Moor in ein ausschließlich von Niederschlagswasser gespeistes Hochmoor über.
Der so entstandene Hochmoorkomplex liegt im Süden des rund 315 Hektar umfassenden Naturschutzgebiets „Rotes Moor“Â und besteht aus dem Großen und dem Kleinen Moor, zwei Bereichen, die durch ein fließendes Gewässer, das „Moorwasser“, voneinander getrennt sind. In diesem Extremlebensraum ist es nur wenigen ausgesprochenen Spezialisten möglich, unter den nährstoffarmen und stark sauren Bedingungen zu gedeihen und sich auszubreiten.
Neben den schon angeführten Torfmoosen nehmen unter den Blütenpflanzen die Zwergsträucher einen breiten Raum ein. Stellvertretend seien die zierliche Moosbeere, die Krähenbeere mit ihren nadelfeinen, immergrünen Blättern und den heidelbeergroßen, tiefschwarzen Beeren, die Rauschbeere sowie die Heidel- und Preiselbeere erwähnt. Als ein typischer Vertreter der Hochmoorfläche ist auch das Scheidige Wollgras zu nennen. Seine bereits im Sommer erscheinenden weißen Wollschöpfe sind ein besonderer Schmuck in der sonst recht eintönigen Moorlandschaft. Ein weiterer Moorspezialist ist der Rundblättrige Sonnentau, eine sehr seltene und unscheinbare Art, die sich als fleischfressende Pflanze im nährstoffarmen Milieu der Moore über den Insektenfang eine zusätzliche Nahrungsquelle erschlossen hat. Als eine Unterart der Moorbirke ist die Karpatenbirke anzusehen, die im Roten Moor ausgedehnte Karpaten-Birkenwälder bildet. Derartige Wälder sind nur in montanen Lagen anzutreffen und gelten als besonderes Wahrzeichen der Hochrhön. Ihre größten und vielgestaltigsten Bestände kommen im Roten Moor vor. An den Moorrändern und im angrenzenden Übergangsbereich finden sich weitere seltene Arten wie Siebenstern, Sumpf-Blutauge, Schmalblättriges Wollgras oder Fieberklee.
Die extremen Standortbedingungen haben zur Folge, dass Hochmoore auch hinsichtlich ihrer Fauna vergleichsweise artenarm sind. So gelingt es nur wenigen Tieren, in diesem Ökosystem geeignete Überlebensmöglichkeiten zu finden. Moorlibellen, moorspezifische Schmetterlinge, Kreuzotter, verschiedene Amphibien sowie eine Reihe von Vögeln wie Wiesenpieper und Bekassine können beobachtet werden. Bemerkenswert ist ferner das Birkhuhn, das in der Rhön eines seiner letzten außeralpinen Vorkommen hat.
Da viele der im Hochmoor lebenden Spezies gefährdet oder vom Aussterben bedroht sind, müssen die wenigen noch vorhandenen Reste dieses sensiblen Lebensraums geschützt und erhalten werden. Denn wie die meisten Moore wurde auch das Rote Moor bis zu seiner Unterschutzstellung im Jahr 1979 systematisch entwässert, abgetragen, urbar gemacht und damit erheblich verkleinert. Anfangs (ab 1809) fand die Abtorfung zu Feuerungszwecken im Handbetrieb statt. Dann – ab 1838 – erweiterte sich der Bedarf an Torf insbesondere für gärtnerische Zwecke und für Heilzwecke in den umliegenden Kurorten. Fast alle benachbarten hessischen und bayerischen Heilbäder bezogen Torf aus dem Riten Moor. iSeit 1960 erfolgte der Torfabbau dann nicht mehr manuell, sondern in größerem Umfang durch Bagger.
Aufgrund dieser jahrzehntelangen Torfgewinnung wurde mehr als die Hälfte der ursprünglichen Hochmoorfläche zerstört bzw. sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Umfangreiche Maßnahmen zur Renaturierung des Hochmoorkörpers waren notwendig. Wenngleich die meisten der seit 1981 durchgeführten Maßnahmen recht erfolgreich waren, erfordert der allgemein starke Rückgang solch naturnahen Lebensräume jedoch weiterhin verstärkte Bemühungen zu deren Stabilität und Erhaltung.