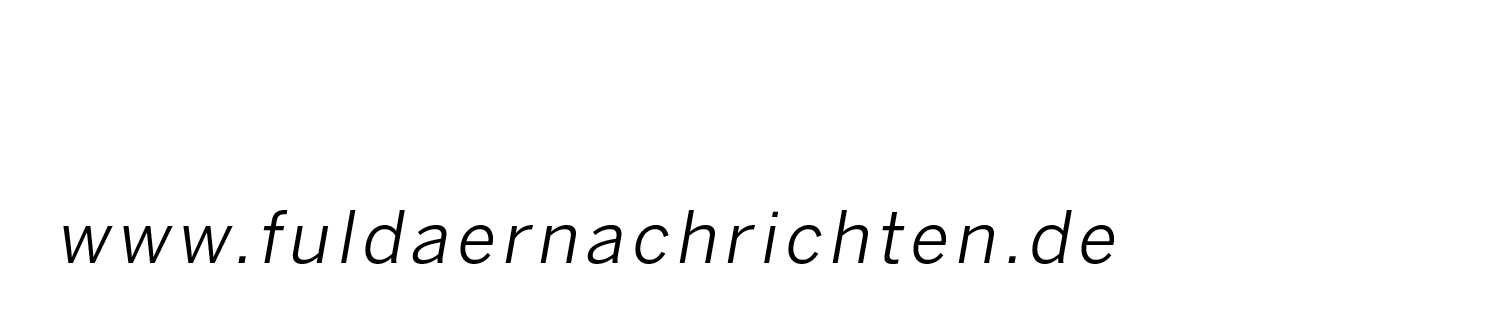Großenlüder-Bimbach. Viele Jahre mit bürokratischem Hin und Her mussten vergehen, bis es 1987 endlich gelang, das „Feuchtgebiet Küppelacker“ in der Gemarkung Oberbimbach wegen seiner Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt zum so genannten flächenhaften Naturdenkmal zu erklären. Der Schriftverkehr zwischen den verschiedenen Behörden und Privatpersonen umfasst eine dicke Akte. Diese beginnt im Juli 1979 mit dem Antrag des damaligen Kreisbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege, Dr. Otto Jost, das „besonders erhaltenswerte Feuchtbiotop bei Bimbach“ unter Schutz zu stellen.
Großenlüder-Bimbach. Viele Jahre mit bürokratischem Hin und Her mussten vergehen, bis es 1987 endlich gelang, das „Feuchtgebiet Küppelacker“ in der Gemarkung Oberbimbach wegen seiner Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt zum so genannten flächenhaften Naturdenkmal zu erklären. Der Schriftverkehr zwischen den verschiedenen Behörden und Privatpersonen umfasst eine dicke Akte. Diese beginnt im Juli 1979 mit dem Antrag des damaligen Kreisbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege, Dr. Otto Jost, das „besonders erhaltenswerte Feuchtbiotop bei Bimbach“ unter Schutz zu stellen.
Wie Jost unter anderem ausführte, liege „eines der wertvollsten Feuchtbiotope unseres Kreises“ südwestlich von Bimbach am Rande des Gieseler Forsts. Es handle sich um eine ehemalige große Sandgrube, deren Wert darin bestehe, „dass sie durch ihre steilen Wände und ihren Umfang ein sehr interessanter geologischer Aufschluss der Buntsandsteinformation ist“. Zugleich gehöre die Grube zu den zoologischen Kostbarkeiten des Landkreises. Bei einer Besichtigung mit dem damaligen Leiter der unteren Naturschutzbehörde, Willy Kiefer, seien – ohne langes Suchen – die nachfolgenden Arten festgestellt worden: Kreuzkröte, Geburtshelferkröte, Teich- und Bergmolch, Neuntöter, Kleinspecht und Heidelerche. Jost schließt: „Die größten Seltenheiten dieser Lebensgemeinschaft sind die beiden Krötenarten. Es gibt kein weiteres Vorkommen dieser Arten in unserem Kreisgebiet!“ Ein Ankauf durch den Landkreis wäre daher dringend wünschenswert.
 Was folgte, waren Anschreiben des früheren Ersten Kreisbeigeordneten Karl Staubach an die verschiedenen Eigentümer des Grundstückes – darunter auch die Gemeinde Großenlüder – mit der Bitte, einem Verkauf zuzustimmen, was sich in der Folgezeit aus den unterschiedlichsten Gründen (unter anderem wegen erheblicher finanzieller Forderungen) allerdings als höchst problematisch herausstellte. Willy Kiefer schließlich schrieb dazu am 31. März 1981, „dass bisher kaum Verkaufsangebote von Grundstückseigentümern eingegangen sind“. Dennoch habe er bei der Bezirksdirektion für Forsten und Naturschutz in Kassel beantragt, das Areal als Feuchtgebiet einstweilig sicherzustellen. Zudem wolle man sich bemühen, über die Stiftung Hessischer Naturschutz Mittel für den Ankauf der Flächen zu erhalten.
Was folgte, waren Anschreiben des früheren Ersten Kreisbeigeordneten Karl Staubach an die verschiedenen Eigentümer des Grundstückes – darunter auch die Gemeinde Großenlüder – mit der Bitte, einem Verkauf zuzustimmen, was sich in der Folgezeit aus den unterschiedlichsten Gründen (unter anderem wegen erheblicher finanzieller Forderungen) allerdings als höchst problematisch herausstellte. Willy Kiefer schließlich schrieb dazu am 31. März 1981, „dass bisher kaum Verkaufsangebote von Grundstückseigentümern eingegangen sind“. Dennoch habe er bei der Bezirksdirektion für Forsten und Naturschutz in Kassel beantragt, das Areal als Feuchtgebiet einstweilig sicherzustellen. Zudem wolle man sich bemühen, über die Stiftung Hessischer Naturschutz Mittel für den Ankauf der Flächen zu erhalten.
Ein weiteres Problem offenbarte sich durch den Unrat, der – einfach hineingeworfen – zu einer Vermüllung der Grube zu führen drohte. Umweltschützer befürchteten, dass beispielsweise durch Hausmüll, Autoreifen und Ölfässer das (noch vorhandene) natürliche Gleichgewicht umkippen könnte. Ein Leserbriefschreiber forderte in der FZ den Gemeindevorstand auf, „so schnell wie möglich mit den Grundstückseigentümern und dem Landkreis die zukünftigen Eigentumsverhältnisse zu regeln“, der Landkreis wiederum möge entsprechende Etatmittel bereitstellen. Großenlüders damaliger Bürgermeister Rudolf Marka erwiderte, dass sich der Gemeindevorstand schon im Januar 1980 für die Ausweisung des Naturschutzgebietes ausgesprochen habe.
Die Folgezeit war gekennzeichnet durch Bemühungen, das Grundstück umzäunen zu lassen (was letztlich im Herbst 1982 geschah), sowie durch mehrere Gutachten, darunter auch von Dr. Franz Müller im Frühjahr 1982. Doch sollte noch ein weiteres Jahr vergehen, bis Erster Kreisbeigeordneter Karl Staubach zumindest die „einstweilige Sicherstellung“ des Areals gemäß Hessischem Naturschutzgesetz erklärte. Bis alle eigentumsrechtlichen Fragen geklärt waren, wurde es freilich Herbst 1985.Dann schrieb die Außenstelle Fulda der Oberen Naturschutzbehörde an den Kreisausschuss, dass nunmehr darum gebeten werde, „die Sicherstellungsverordnung in eine Naturdenkmalsverordnung umzuwandeln“.