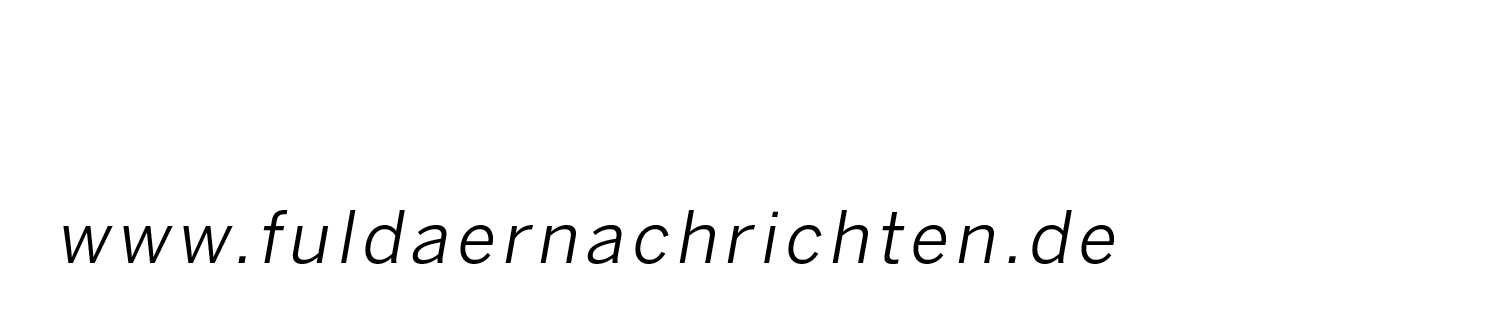„Immer wieder versuchen Gruppen und Interessenverbände bei uns wie in anderen europäischen Ländern eine ‚aktive Sterbehilfe‘ zu ermöglichen. Anders als dieser Begriff suggeriert, geht es dabei nicht darum, Menschen beim Sterben zu helfen, sondern ganz bewusst und gezielt darum, ihren Tod herbeizuführen.“ Das hob der Fuldaer Bischof Heinz Josef Algermissen in einem feierlichen Pontifikalamt am Ostersonntag im Fuldaer Dom hervor. Für österliche Christen sei „aktive Sterbehilfe“ keine Möglichkeit, sondern einzig intensivste Sterbebegleitung. „Wir verstehen darunter den medizinischen, pflegerischen, sozialen und seelsorglichen Beistand auf dem allerletzten Weg.“ Eine große moralische Niederlage wäre es, die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen dafür nicht zu schaffen, gab Algermissen in seiner letzten Osterpredigt zu bedenken. Sterbebegleitung sei im Gegensatz zu „aktiver Sterbehilfe“ konkret erfahrbare Lebenshilfe. „Es ist sehr hilfreich, an der Hand eines anderen Menschen und also nicht einsam sterben zu können, indes nicht durch dessen Intervention.“ Die Gegenwart des gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus sei besonders in denen zu erkennen, „die leiden und sterben, Angst haben vor dem letzten Weg und keinen Ausweg mehr zu finden glauben“.
Der Bericht Maria Magdalenas davon, dass Christus von den Toten auferstanden sei, sei auf eine eingeschüchterte, verängstigte Jüngerschar getroffen, betonte Algermissen zu Beginn seiner Predigt. Zu deprimierend seien die Erlebnisse der letzten Tage gewesen, besonders der Karfreitag, und sie seien unsicher gewesen, ob sie Jesus überhaupt noch unter die Augen treten konnten, wo sie ihn doch feige im Stich gelassen hätten. Die Botschaft von der Auferstehung des Herrn treffe auch heute auf eine verunsicherte Kirche, der der Wind „kalt und scharf“ ins Gesicht blase. „Wir spüren, wie sich das Klima in der Öffentlichkeit geändert hat. Zeichen dafür sind eine oft hämische und destruktive Kirchenkritik in den Medien und eine Gesetzgebung zumal in bioethischen Fragen, die mit christlichen Grundsätzen oft nicht vereinbar ist.“ Der Bischof bezeichnete es als erstaunlich, wie man heutzutage mit eigentlich nicht verhandelbaren Grundprinzipien der menschlichen Würde verfahre, die den Vätern des Grundgesetzes noch plausibel gewesen seien. Auch im innerkirchlichen Bereich machten sich Sorgen angesichts von Strukturänderungen und eines Rückbaus breit – es sei eben schwer zu ertragen, dass alles weniger werde. „Da mag es zunächst wie eine leere Worthülse klingen, wenn man allzu schnell die Antwort parat hat, dass der Osterglaube uns Gewissheit und Halt in allen Turbulenzen schenkt. Viele Christen mögen es tatsächlich so erfahren. Aber es gibt auch die anderen, die ebenso ratlos vor der Osterbotschaft stehen wie die Jünger am Ostermorgen.“
Das Evangelium des Ostertages erzähle ausführlich von Maria Magdalena, wie sie dem Auferstandenen begegnete und ihn zunächst nicht erkannte. Auch die erste Reaktion der Jünger auf das Geschehen des Ostermorgens war keineswegs ein bereitwilliger, froher Glaube, sondern sie hielten die Erzählung der Frauen für „Geschwätz“. „Die Apostel waren auf diese Botschaft nicht gefasst und konnten sie zunächst nicht glauben.“ Als Jesus später den Aposteln erschien, „tadelte er ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten“ (Mk 16,14). Nur sehr langsam und durch Krisen hindurch sei ihr Osterglaube gewachsen. „Der christliche Glaube, zumal der an die Auferstehung Jesu Christi, ist nicht das Ergebnis menschlicher Überlegungen und rationaler Beweisführung. Er ist Geschenk der Gnade, Frucht des Geistes Gottes in uns“, zeigte sich Algermissen überzeugt.
Sodann stellte der Oberhirte auch die Frage nach dem je eigenen Osterglauben der Christen. „Dieser Glaube führt uns ja heute zum Festgottesdienst hier in unserem Hohen Dom zusammen, um die alles verändernde österliche Erfahrung in uns zu verlebendigen.“ Bewähren und profilieren müsse sich dieser Glaube in einer Gesellschaft, die sich immer mehr von christlichen Grundsätzen entferne. Christen müssten sich unbedingt dort massiv als Störenfriede einsetzen, wo die Mächte des Todes am Werk seien. Da konkret hätten sich der Glaube an die Auferstehung und die österliche Perspektive des christlichen Lebens zu beweisen und seien die Gläubigen „zu klarer Position aus dem Osterglauben aufgefordert, ohne fatale Kompromisse zu schließen“. Bewähren müsse sich der österliche Glaube laut dem Bischof auch in den Stunden persönlicher Grenzsituationen und schließlich am letzten großen Karfreitag des eigenen Lebens, wenn der Tod bei einem anklopfe.
Wenn alles menschliche Wissen und Können am Ende sei, dann dürften Christen mit dem Apostel Paulus bekennen: „Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende“ (Röm 14,7-9). Mit diesem Glauben seien die Christen unterwegs; er gebe ihnen sicheren Halt. „Das ist der Glaube, der durch Krisen hindurch in uns reifen soll, um den wir uns mühen, den wir aber vor allem erbitten müssen“, so der Bischof. Mit diesem Glauben könne man das Leben mit seinen Herausforderungen, Aufgaben, Problemen, mit seinen Unbegreiflichkeiten und Kreuzen bestehen. „Mit diesem Osterglauben können wir vertrauensvoll leben ─ und einmal zuversichtlich sterben“, schloss der Oberhirte.