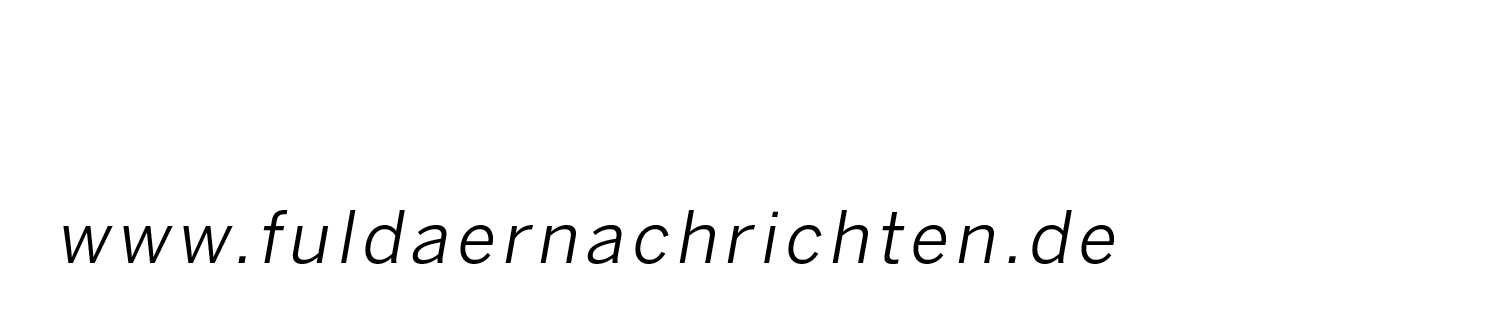Gicht (medizinisch „Urikopathie“) ist eine Stoffwechselerkrankung, die in Schüben verläuft und sich durch stark schmerzende und geschwollene Gelenke bemerkbar macht. Hintergrund ist eine erhöhte Harnsäure-Konzentration im Blut, die langfristig zu Schädigungen der Gelenke und des Gewebes führen kann.
Ursache
Harnsäure ist ein natürliches Abbauprodukt der so genannten „Purinbasen“, das normalerweise über den Urin ausgeschieden wird. Purine wiederum sind Bauteile von unseren Körperzellen – zum einen können wir Purin über die Nahrung aufnehmen, zum anderen werden sie durch die ständige Erneuerung der Körperzellen frei gesetzt. Daher kann eine erhöhte Harnsäure-Konzentration verschiedene Gründe haben: Übermäßiger Verzehr purinhaltiger Lebensmittel (z.B. Wurst und Innereien), übermäßiger Zellabbau oder eine Funktionsstörung der Niere, die normalerweise die Ausscheidung von Harnsäure im Urin steuert.
Symptome (akut)
Ein Gichtanfall tritt meist völlig unerwartet auf und ist sehr schmerzhaft. Dabei schwillt ein Gelenk stark an, wird heiß, rot und extrem berührungsempfindlich. Fieber kann ebenfalls eine Begleiterscheinung sein. Bei vielen Menschen ist das Grundgelenk der großen Zehen betroffen – diesen Gichtanfall nennt man dann „Podagra“. Es können aber auch andere Gelenke, wie zum Beispiel das Handgelenk oder die Daumengrundgelenke betroffen sein. Die Schmerzen können unbehandelt von ein paar Stunden bis hin zu Wochen andauern.
Folgen
Die in der Harnsäure enthaltenen Salze lagern sich ab und führen langfristig zu Verformungen der Gelenke und Sehnen sowie des Gewebes. Wenn sich kleine Knötchen aus den Ablagerungen bilden, spricht man von so genannten „Gicht-Tophi“. Um Nierenschäden und chronischen Schmerzen vorzubeugen, sollte ein Gichtanfall unbedingt behandelt werden.
Behandlung
Heutzutage gibt es vielfältige Behandlungsmethoden gegen Gicht. Häufig werden entzündungshemmende Schmerzmittel, Kortison oder Colchicin, verschrieben. Es empfiehlt sich, das Gelenk zu schonen und zu kühlen. Grundsätzlich sollte versucht werden, Risikofaktoren zu vermindern und Essgewohnheiten zu verbessern. Dazu zählen ausreichend trinken, auf eine gesunde und purinarme Ernährung achten, viel bewegen und Alkohol sowie Übergewicht reduzieren.