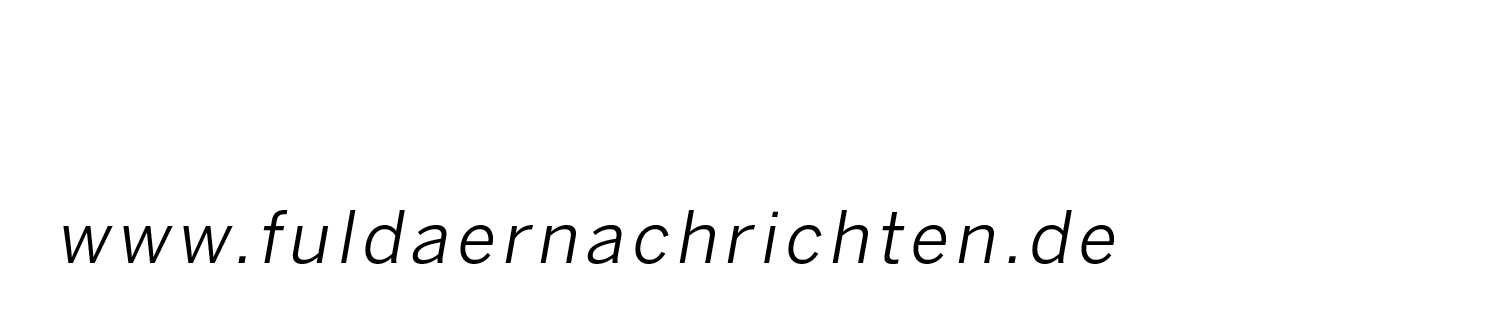Rhön. Dem Biosphärenreservat Rhön ist es gelungen, innerhalb eines Jahrzehnts bundesweit wesentlich bekannter zu werden. Das ist das Ergebnis einer Allensbach-Studie, die 2011 durchgeführt und jetzt präsentiert wurde.
Im Rahmen dieser Repräsentativ-Umfrage wurde nicht die Rhöner Bevölkerung selbst befragt, sondern Personen aus der gesamten Bundesrepublik. 2003 war diese Befragung nach genau demselben Schema schon einmal durchgeführt worden.
Die neue Allensbach-Studie kommt zu dem Schluss, dass die 15 deutschen UNESCO-Biosphärenreservate ihren Bekanntheitsgrad von 2003 bis 2011 fast um die Hälfte auf nunmehr 62 Prozent steigern konnten. Das Biosphärenreservat Rhön konnte dabei überdurchschnittlich hinzugewinnen. Unter allen deutschen Biosphärenreservaten kletterte die Rhön auf der Bekanntheits- wie auf der Akzeptanzskala bundesweit auf den vierthöchsten Platz. Noch 2003 landete die Rhön auf dem 8. Platz. Den ersten Platz belegt aktuell das Biosphärenreservat Spreewald.
Laut der Studie von Allensbach denkt inzwischen jeder dritte Deutsche, dem das Wort Biosphärenreservat überhaupt ein Begriff ist, an das Biosphärenreservat Rhön. Jeder vierte bekundet sein ausdrückliches Interesse am Biosphärenreservat Rhön. Bezogen auf die Bevölkerung bedeutet das insgesamt, dass sich das Interessenten-Potential am Biosphärenreservat Rhön um fast zwei Drittel auf 16 Prozent ausdehnen konnte. 2003 waren es noch zehn Prozent.
Interessant ist auch die Tatsache, dass sich das Biosphärenreservat Rhön am ehesten im Wettbewerb mit den Biosphärenreservaten Spreewald, Berchtesgadener Land, Wattenmeer, Flusslandschaft Elbe und der Schwäbischen Alb befindet.
In der Studie von Allensbach wird allerdings auch deutlich, dass es bei vielen Menschen immer noch ein teilweise völlig falsches Verständnis von einem Biosphärenreservat der UNESCO gibt. Zwar nahmen die unzutreffenden Vorstellungen gegenüber 2003 ab, aber es gibt sie immer noch in nicht unbeträchtlichem Maße, vor allem bezüglich wirtschaftlicher Aspekte. Immerhin die Hälfte der Befragten glaubt zum Beispiel, dass sich in einem Biosphärenreservat keine Betriebe ansiedeln dürfen. Viele sind darüber hinaus der Meinung, dass sich in Biosphärenreservaten auf der ganzen Fläche die Natur völlig ohne jeglichen Eingriff des Menschen entwickeln kann.
Getreu der Idee von Friedrich Wilhelm Raiffeisen „Das Geld dem Dorfe dem Dorfe“ haben sich vor allem in der bayerischen Rhön viele Energiegenossenschaften gebildet, um die alternative Energieerzeugung voranzubringen.
 „Die Wiederholung dieser Studie hat sich aus meiner Sicht gelohnt. Das Biosphärenreservat Rhön ist im bundesweiten Vergleich in der Wahrnehmung nicht stehengeblieben, sondern konnte sich im Wettbewerb der Regionen deutlich nach vorne bewegen. Leider sagt die Studie nicht, aus welchen Gründen wir derart zulegen konnten, aber das war auch nicht ihre Aufgabe. Bei der nächsten Wiederholung sollten wir diesen Aspekt aus meiner Sicht jedoch dringend untersuchen lassen“, meint der Leiter der bayerischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön, Regierungsdirektor Michael Geier.
„Die Wiederholung dieser Studie hat sich aus meiner Sicht gelohnt. Das Biosphärenreservat Rhön ist im bundesweiten Vergleich in der Wahrnehmung nicht stehengeblieben, sondern konnte sich im Wettbewerb der Regionen deutlich nach vorne bewegen. Leider sagt die Studie nicht, aus welchen Gründen wir derart zulegen konnten, aber das war auch nicht ihre Aufgabe. Bei der nächsten Wiederholung sollten wir diesen Aspekt aus meiner Sicht jedoch dringend untersuchen lassen“, meint der Leiter der bayerischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön, Regierungsdirektor Michael Geier.
Für ihn ist vor allem von Bedeutung, mit welchen kapitalen Missverständnissen der Begriff Biosphärenreservat auf bundesweiter Ebene immer noch belastet ist. „Da haben wir in Zukunft viel zu tun, um dieses schiefe Image auszuräumen – und zwar auf der Ebene der Verwaltungsstellen, des Beirats und auch auf Bundesebene“, hebt Geier hervor. Wichtig sei es, zunächst innerhalb der Region Aufklärungsarbeit zu leisten. Wenn die Leute vor Ort besser über die Ziele eines Biosphärenreservats Bescheid wüssten, könnten sie das auch gezielt dem Gast und damit dem Außenstehenden vermitteln, ist sich Geier sicher.
„Ich freue mich, dass die Rhön als Biosphärenreservat in den letzten zehn Jahren weitaus bekannter geworden ist. Das hat enorme Auswirkungen für den Tourismus, vor allem im thüringischen Teil, der ja sehr lange im Dornröschenschlaf gelegen hat. Die Bemühungen hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit, der Beteiligung an Messen oder Ausrichtung sonstiger Veranstaltungen wie der Besuch mit Partnerbetrieben der Bundesgartenschau in Schwerin scheinen sich da widerzuspiegeln“, sagt der Leiter der Thüringer Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön, Karl-Friedrich Abe. Laut der Allensbach-Studie sei das Biosphärenreservat Rhön mit 53 Prozent in Bayern am bekanntesten. Danach folgen mit jeweils 41 Prozent die Bundesländer Thüringen und Sachsen, dann mit 34 Prozent Norddeutschland und mit 33 Prozent das Rhein-Main-Gebiet. „Das ist für mich persönlich eine sehr wichtige Information, weiter in Thüringen und Sachsen für unser Biosphärenreservat zu werben, Chancen für die Region zu eröffnen und auch noch mehr Werbung im Rhein-Main-Gebiet zu machen, das ja gewissermaßen vor unserer Haustür liegt.“
Das Biosphärenreservat Rhön ist in punkto Direktvermarktung regionaler Produkte beispielgebend für andere deutsche Biosphärenreservate. Dieses Bild entstand im Hofladen der Agrargenossenschaft Rhönland e.G. im thüringischen Dermbach.
 Dass sich die Anziehungskraft des Biosphärenreservats Rhön im zurückliegenden Jahrzehnt wesentlich verbessert hat, ist laut Abe auch ein Verdienst der Region hinsichtlich der Regionalität und Qualität der hier angebotenen Produkte. Regionales Essen und Trinken seien bei einem Gast von außerhalb immer gefragt.
Dass sich die Anziehungskraft des Biosphärenreservats Rhön im zurückliegenden Jahrzehnt wesentlich verbessert hat, ist laut Abe auch ein Verdienst der Region hinsichtlich der Regionalität und Qualität der hier angebotenen Produkte. Regionales Essen und Trinken seien bei einem Gast von außerhalb immer gefragt.
„Biosphärenreservate gibt es weltweit gerade einmal seit 40 Jahren. Die Kategorien Nationalparke oder Naturparke sind in der Regel älter, und in Deutschland haben die Biosphärenreservate gerade einmal ein Alter von 20 bis 25 Jahren erreicht. Insofern ist es schon auch verständlich, dass der Begriff noch immer teilweise unkorrekt gedeutet wird“, meint Abe. „In diesen Missverständnissen sehen wir aber auch die Aufgabe, dass wir weiterhin Informationsveranstaltungen durchführen und aufklären müssen. Vor allem bei den jungen Leuten gibt es hinsichtlich der Bedeutung des Begriffs Biosphärenreservat großen Nachholbedarf“, unterstreicht der Leiter der Thüringer Verwaltungsstelle.
Auch Torsten Raab, Leiter der Hessischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön, ist der Auffassung, dass sich der Begriff „Biosphärenreservat“ als solcher noch nicht ganz durchgesetzt hat. Zu oft werde er noch mit Nationalpark, Naturpark, Landschaftsschutzgebiet und Naturschutzgebiet verwechselt. Die Rhön sei darüber hinaus das einzige Biosphärenreservat in ganz Hessen – das erkläre vielleicht auch die im Vergleich zu Bayern, Thüringen und Sachsen etwas geringere Bekanntheit von Biosphärenreservaten in diesem Bundesland.
Raab hofft, in Zukunft schon mit kleineren Maßnahmen dazu beitragen zu können, die Besucher der Region stärker mit dem Biosphärenreservat vertraut zu machen. „Aus meiner Sicht müssen wir besser erklären, wo das Biosphärenreservat Rhön eigentlich beginnt und wo es endet, damit die Menschen überhaupt wissen, dass sie sich im Biosphärenreservat Rhön befinden. Wir haben das zwar mit kleineren Zusatzschildern an den Ortseingangsschildern versucht zu kommunizieren, aber vielleicht brauchen wir einfach größere Eingangsportale, um die Grenzen des Biosphärenreservats erlebbar zu machen“, meint Raab. Ein weiterer Aspekt sind für ihn überregional tätige Partner, die für das Biosphärenreservat Rhön werben, so wie es beispielsweise der Mineralbrunnen Rhönsprudel schon seit vielen Jahren tut und dazu beiträgt, die Rhön über seine Grenzen hinaus bekanntzumachen.
 Innerhalb der Region müsse sich nach Raabs Ansicht vor allem die touristische Werbung zusammen mit dem Begriff „Biosphärenreservat“ als einer Qualitätsregion verbessern. „Unser Biosphärenreservat und unsere einzigartige Landschaft tragen ein offizielles Prädikat, das uns nicht irgendjemand, sondern die Weltkulturorganisation UNESCO verliehen hat. Dieses Prädikat müssen wir ganz anders in die touristische Waagschale werfen als bisher“, hebt Raab hervor. Die UNESCO-Auszeichnung sei ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, das noch besser herausgestellt werden müsse. „Das Erleben von Natur und Landschaft sind absolute Trendthemen, die wir auf höchstem Niveau bedienen können.“ Außerdem müsse das Biosphärenreservat Rhön dort beworben werden, wo viele Menschen zu erreichen sind – beispielsweise in Ballungszentren oder auch in überregionalen Zeitschriften und Magazinen, um gezielt anspruchsvolle Gäste und Naturliebhaber für mehrtägige Reisen in die Rhön zu locken.
Innerhalb der Region müsse sich nach Raabs Ansicht vor allem die touristische Werbung zusammen mit dem Begriff „Biosphärenreservat“ als einer Qualitätsregion verbessern. „Unser Biosphärenreservat und unsere einzigartige Landschaft tragen ein offizielles Prädikat, das uns nicht irgendjemand, sondern die Weltkulturorganisation UNESCO verliehen hat. Dieses Prädikat müssen wir ganz anders in die touristische Waagschale werfen als bisher“, hebt Raab hervor. Die UNESCO-Auszeichnung sei ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, das noch besser herausgestellt werden müsse. „Das Erleben von Natur und Landschaft sind absolute Trendthemen, die wir auf höchstem Niveau bedienen können.“ Außerdem müsse das Biosphärenreservat Rhön dort beworben werden, wo viele Menschen zu erreichen sind – beispielsweise in Ballungszentren oder auch in überregionalen Zeitschriften und Magazinen, um gezielt anspruchsvolle Gäste und Naturliebhaber für mehrtägige Reisen in die Rhön zu locken.
Auch die Zusammenarbeit zwischen großen Unternehmen und Landwirten – wie hier zwischen der Bionade GmbH und einem ortsansässigen Landwirt – ist typisch für das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön und stellt ebenfalls einen bedeutenden Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaften dar.
Der Leiter der Hessischen Verwaltungsstelle nennt noch einen anderen Aspekt, der aus seiner Sicht zu einem falschen Inhaltsverständnis des Begriffs Biosphärenreservat beiträgt: „Wir beschäftigen uns in der öffentlichen Diskussion immer wieder mit Verboten statt vermehrt mit Chancen, die ein Biosphärenreservat bietet. Auch die Diskussion um die Kernzonenerweiterung geht in diese Richtung. Wir leben im Biosphärenreservat aber nicht unter einer Käseglocke. Bei uns können gute Ideen, die nachhaltig ausgerichtet sind, auch umgesetzt und erprobt werden. Wir sollten die Chance, UNESCO-Modellregion zu sein, noch besser nutzen und offensiv propagieren, statt immer nur über Probleme, Gefahren und Risiken zu diskutieren. Die Rhön bietet uns Chancen, die wir nutzen sollten.“
Der detaillierte Inhalt der neuen Allensbach-Studie ist auch im Internet unter www.brrhoen.de nachzulesen.