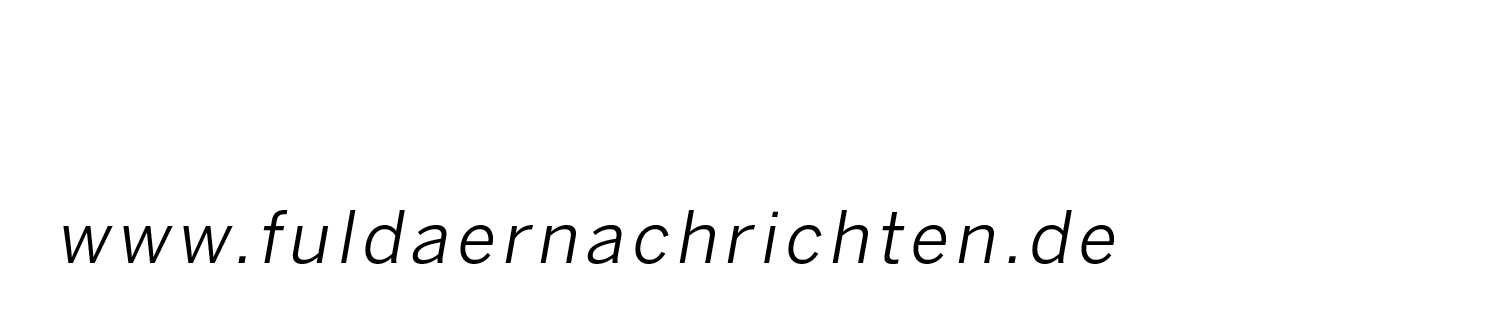Rhön. Mit dem Verschwinden des letzten Schnees in den Hochlagen der Rhön zeigt sich erstes frisches Grün. Zu den Frühlingsboten in den Rhöner Laubwäldern zählt auch der Bärlauch, der auf feuchte, nährstoffreiche Böden angewiesen ist. Er ist ein beliebtes Wildkraut mit Knoblaucharoma und wird daher gern in der Küche verwendet. Das Sammeln in Naturschutzgebieten ist allerdings Tabu – darauf weist jetzt die Hessische Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön hin.
Rhön. Mit dem Verschwinden des letzten Schnees in den Hochlagen der Rhön zeigt sich erstes frisches Grün. Zu den Frühlingsboten in den Rhöner Laubwäldern zählt auch der Bärlauch, der auf feuchte, nährstoffreiche Böden angewiesen ist. Er ist ein beliebtes Wildkraut mit Knoblaucharoma und wird daher gern in der Küche verwendet. Das Sammeln in Naturschutzgebieten ist allerdings Tabu – darauf weist jetzt die Hessische Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön hin.
Genutzt werden die frischen grünen Blätter vor der Blütezeit von April bis Ende Mai. In der Rhön ist der Bärlauch nicht häufig und meist nur kleinflächig anzutreffen. Viele der Vorkommen liegen in Schutzgebieten, wo generell zum Schutze der Pflanzen nicht gesammelt werden darf.
Martin Kremer, Sachgebietsleiter Biosphärenreservat Rhön beim Landkreis Fulda, macht darauf aufmerksam, dass nach § 41 des Bundesnaturschutzgesetzes der Bärlauch auch außerhalb der Schutzgebiete einen Mindestschutz genießt. Es sei untersagt, „ohne vernünftigen Grund wild lebende Pflanzen von ihrem Standort zu entnehmen oder zu nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten“ sowie deren „Lebensstätten zu beeinträchtigen oder zu zerstören“. In den letzten Jahren sei es immer wieder zu Konflikten gekommen, weil die Nachfrage in der Region groß ist; das Angebot an wildem Bärlauchvorkommen in den Wäldern dagegen gering. „Wiederholt wurden kleine Bärlauchvorkommen, teilweise für kommerzielle Verwendung, stark abgeerntet und dadurch der Bestand dezimiert“, sagt Kremer.
Rhönbotaniker Uwe Barth macht deutlich, dass es nicht angehen kann, dass Bärlauch flächig abgemäht wird. Dies begründet er nicht nur mit dem Schutz der Pflanzen an sich, sondern auch mit dem Schutz des Konsumenten. Immer wieder habe es in der Vergangenheit in Deutschland tödliche Vergiftungen gegeben, weil Bärlauch mit giftigen Doppelgängern wie etwa der Herbstzeitlose, dem Aronstab oder dem Maiglöckchen verwechselt und verzehrt wurde. „Bei Wildvorkommen kann nie ausgeschlossen werden, dass andere Pflanzen, vielleicht auch giftige, zwischen den Bärlauchblättern wachsen. Deshalb muss sehr sorgfältig und mit Kenntnis gesammelt werden“, erklärt Barth.
Biosphärenreservat Rhön und Rhönbotaniker stimmen überein, dass Menschen, die Bärlauch sammeln möchten und die Pflanze sicher erkennen, dies in kleinen Mengen für den eigenen Haushalt auch tun sollten, selbstverständlich außerhalb von Naturschutzgebieten. Für eine Sammeltätigkeit im größeren Umfang bedürfe es der Genehmigung des Grundeigentümers und der Naturschutzbehörde. Werde das gesammelte Kraut verkauft, so liege eine gewerbliche Tätigkeit vor, die zusätzlicher Genehmigungen und eines Gewerbescheins bedürfe.
Biologe Barth appelliert an die Bärlauchfreunde, möglichst nur pro Pflanze ein Blatt zu ernten und keinesfalls Zwiebeln auszugraben, um die Bestände zu schonen. Er verweist darauf, dass inzwischen auf gute Produkte des Gartenhandels zurückgegriffen werden könne. Bärlauch lasse sich vergleichsweise leicht kultivieren, was unter anderem auch bereits für kommerzielle Zwecke erfolgreich praktiziert wird. Voraussetzung für ein üppiges Gedeihen sei ein humus- und nährstoffreicher Boden mit viel Feuchtigkeit und Beschattung. “Trockenheit und Sonne mag der Waldknoblauch nicht. Für den Anbau im Garten ist wichtig, dass die Samen so genannte Kältekeimer sind, das bedeutet, dass sie eine Frostperiode erlebt haben müssen“, sagt Barth. Bedeutsam sei die vegetative Vermehrung durch Tochterzwiebeln. Diese trage zu einer raschen Vermehrung bei, vorausgesetzt dass der Standort passt.
Ausdrücklich verweist das Biosphärenreservat Rhön darauf, dass ein Ausgraben der in Frost sicherer Tiefe sitzenden Zwiebeln in der freien Natur verboten ist. „Die Naturwacht des Biosphärenreservats ist in den nächsten Wochen dazu angehalten, die Bärlauchbestände in den Schutzgebieten regelmäßig zu kontrollieren“, unterstreicht Kremer.