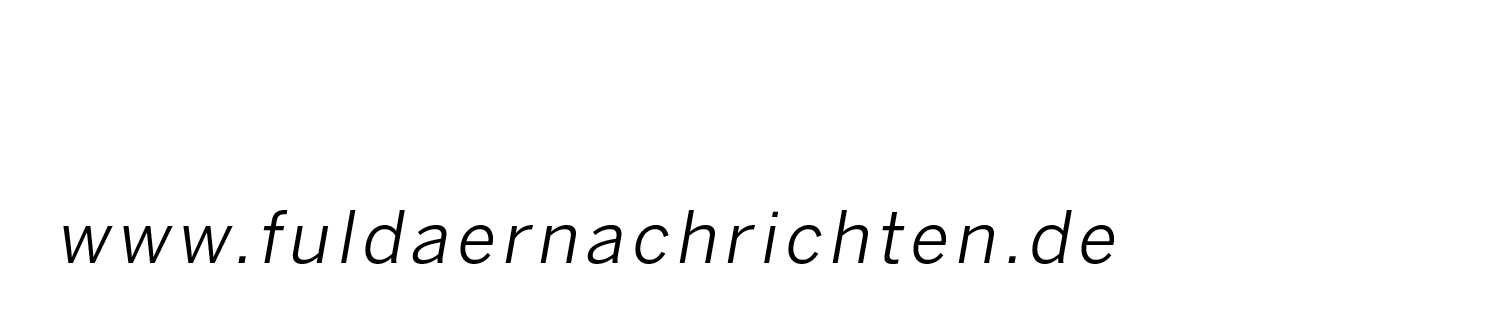Fulda. Die Volkshochschule der Stadt Fulda nimmt sich bei ihrer Reihe „vhs im Museum“ immer einem interessanten Aspekt der Stadtgeschichte an. Zum ersten Mal wurden nun die Brunnen in Fulda thematisiert. „Die Wasserversorgung war das A und O bei der Stadtgründung“, klärte Dr. Udo Lange, der die Veranstaltung zusammen mit Kulturamtsleiter Dr. Werner Kirchhoff durchführte, die 20 Teilnehmer auf. In Fulda gibt es heute etwa 40 Brunnen, für deren Pflege und Instandhaltung die Stadt jedes Jahr circa 60.000 € ausgibt.
Fulda. Die Volkshochschule der Stadt Fulda nimmt sich bei ihrer Reihe „vhs im Museum“ immer einem interessanten Aspekt der Stadtgeschichte an. Zum ersten Mal wurden nun die Brunnen in Fulda thematisiert. „Die Wasserversorgung war das A und O bei der Stadtgründung“, klärte Dr. Udo Lange, der die Veranstaltung zusammen mit Kulturamtsleiter Dr. Werner Kirchhoff durchführte, die 20 Teilnehmer auf. In Fulda gibt es heute etwa 40 Brunnen, für deren Pflege und Instandhaltung die Stadt jedes Jahr circa 60.000 € ausgibt.
Die Brunnenmeister
Die öffentlichen und privaten Brunnenanlagen sind über die ganze Stadt und ihre Stadtteile verteilt, da das Bach- und Kanalwasser schon bald nach der Stadtgründung nicht mehr ausreichte. Als die Wasserversorgung noch über die Brunnen der Stadt sichergestellt wurde, setzte die Stadt so genannte Brunnenmeister ein, die für die Pflege und Sauberkeit der Brunnen verantwortlich waren.
Sie richteten auch einmal im Jahr ein Fest, die Brunnenzeche, aus. Der Verein „Florengässner Brunnenzeche e.V. Fulda“ knüpft noch heute an diese Zeit an. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind die meisten Brunnen abgebaut und zugedeckt worden, da sie mit der Einführung der zentralen Wasserversorgung ihre Funktion verloren hatten.
Die ältesten Brunnen Fuldas

 Anhand einer Katasterkarte aus dem Jahre 1727, auf der allerdings nur die damaligen öffentlichen Brunnen erfasst sind, gaben die Referenten einen Überblick über die alten Brunnen in Fulda. Allerdings sei sicherlich eine Vielzahl von Brunnen privat gegraben und nie dokumentiert worden, betonte Dr. Lange. Der Kronhofbrunnen am Kronhof, der ungefähr in der Zeit um 750 errichtet und 1952 neu gefasst wurde, ist der älteste Brunnen in Fulda.
Anhand einer Katasterkarte aus dem Jahre 1727, auf der allerdings nur die damaligen öffentlichen Brunnen erfasst sind, gaben die Referenten einen Überblick über die alten Brunnen in Fulda. Allerdings sei sicherlich eine Vielzahl von Brunnen privat gegraben und nie dokumentiert worden, betonte Dr. Lange. Der Kronhofbrunnen am Kronhof, der ungefähr in der Zeit um 750 errichtet und 1952 neu gefasst wurde, ist der älteste Brunnen in Fulda.
Die Teilnehmer erfuhren zudem, dass der Gartenbrunnen in der Straße Am Gartenbrunnen parallel zur Langebrückenstraße bereits 1461 erwähnt worden ist. Der Brunnen läuft heute nicht mehr und ist aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verschwunden, wie Dr. Lange darlegte und betonte, dass „viele Bürger sogar nach dem Krieg aufgrund der hervorragenden Wasserqualität noch ihr Kaffeewasser von dort geholt haben“.
Zisternen im Museumshof
Auf dem Gelände des Museums sind zum Beispiel vier Brunnen gewesen. Als Besonderheit dieses Standorts führte Dr. Kirchhoff die vier Regenwasserzisternen unter dem Hof an, deren Verlauf heute noch durch eine Steinmarkierung im Boden verzeichnet ist und der den Teilnehmern auch vor Ort gezeigt wurde. Diese Wasserreserve sei hier angelegt worden, da man aufgrund des Abfangens des Dachwassers ein großes Gebäude benötigte und aufgrund des Geländeabfalls eine Verteilung des Wassers möglich gewesen sei, so der Kulturamtsleiter.
„Die Zisternen sehen aus wie große Gewölbekeller mit Zu- oder Abläufen am Rand und dürften etwa 200 Kubikmeter Wasser umfasst haben“, erklärte Dr. Kirchhoff. Praktisch sei dieser Standort sicherlich auch für den Pferdestall des Päpstlichen Seminars direkt nebenan gewesen, da man somit direkten Zugriff auf das Wasser für die Tiere gehabt habe. (cp)