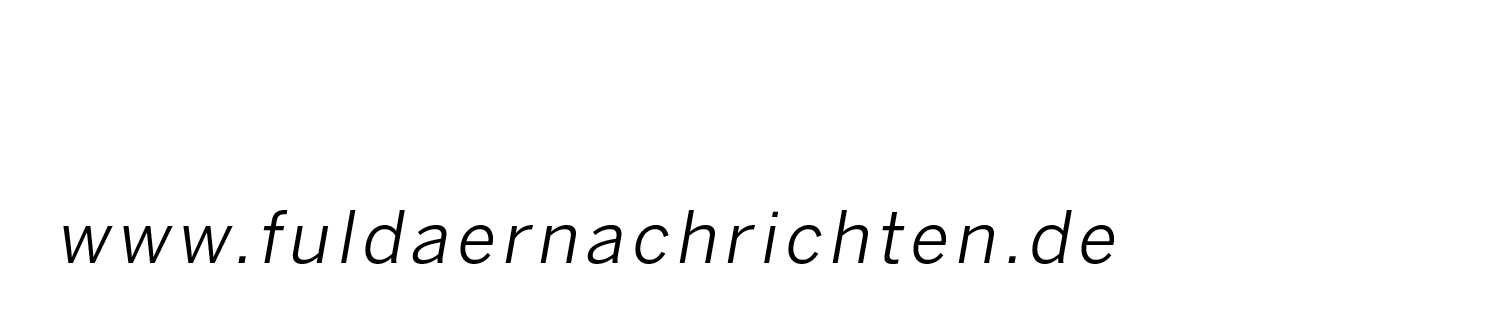Essen/Fulda. Der Fuldaer Bischof Heinz Josef Algermissen rief am Holocaust-Gedenktag, 27. Januar, in Essen zu einer permanenten Aufarbeitung der jüngsten Vergangenheit auf. In einem Pontifikalamt in der Pax-Christi-Kirche am 65. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz hinterfragte der Oberhirte, wie nachhaltig Deutschland und Europa aus der alle Maßen übersteigenden Katastrophe gelernt hätten. Immer wieder flackere der Antisemitismus auf. Auch in Deutschland werde er deutlich sichtbar. „So liegt weiterhin ein langer Weg der Läuterung und der Auseinandersetzung vor uns. Gehen wir ihn miteinander“, forderte der Bischof auf.
In seiner Predigt hatte Bischof Algermissen zuvor betont, daß Auschwitz wie kein anderer Ort für den größten Genozid in der Geschichte der Menschheit stehe, die Vernichtung von rund sechs Millionen Juden. „In Auschwitz ist unsere Zivilisation in furchtbarer Weise mit dem Abgrund ihrer eigenen Möglichkeiten konfrontiert worden. Der Schrecken über das Ausmaß des Bösen, das dort begangen wurde, hält uns bis heute gefangen. Noch immer haben wir für dieses Verbrechen, das die hebräische Sprache als ‚Schoa’ bezeichnet, kein angemessenes deutsches Wort gefunden.“
Dem bekannten Ausspruch, nach Auschwitz könne es keine Dichtung mehr geben, liege die Erfahrung dieser Unfähigkeit zugrunde, mit den Mitteln der Sprache das Geschehen von Auschwitz und dessen andauernde Folgen für das Selbstverständnis des Menschen, für Zivilisation und Gesellschaft angemessen zu fassen. Gerade die Überlebenden selbst aber hätten sich immer wieder auf die Suche nach einer Sprache begeben, die diesem Menschheitsverbrechen Ausdruck verleihen könnte.
Das deutsche Volk habe lange gebraucht, sagte der Bischof, um sich der Verantwortung „für das monströse Verbrechen zu stellen, das von Deutschen und im deutschen Namen begangen wurde“. Bis heute seien Mechanismen der Verdrängung wirksam. Zweifellos sei es richtig, die Vorstellung einer Kollektivschuld abzulehnen. „Wahr ist aber auch, daß sich weit mehr Deutsche persönlich schuldig gemacht haben, als ihre Mitschuld einzugestehen bereit waren. Schuld tragen nicht allein die Täter vor Ort und die politische Führung. In verschiedenen Graden haben auch die Mitläufer und alle diejenigen, die weggesehen haben, Mitschuld auf sich geladen.“
Den 27. Januar zu begehen, sei für Christen eine Verpflichtung, stellte Algermissen heraus. „Wir handeln als solche, die nicht davon lassen können, Menschengeschichte immer auch vor das Angesicht Gottes zu stellen in aller Ratlosigkeit und mitunter ohne Antwort.“ Vielleicht liege die Hauptaufgabe christlicher Erinnerung darin, die Wunden offen zu halten, nicht zu versuchen, das Unvorstellbare plausibel zu machen, den Abgrund zuzuschütten.
Es folge daraus, daß christliche Erinnerung letztlich unspektakulär Widerstand leiste gegen eine schleichende kulturelle Amnesie, in der es nur noch Siegertypen geben dürfe und keine Opfer mehr vorkommen könnten. „Wenn namhafte Theologen heutzutage als Charakteristikum unserer Gesellschaft die Gottes-Amnesie, die Gottvergessenheit, ausmachen, bedeutet das nicht auch, daß dort, wo Gott vergessen wird, auch der Mensch, der erniedrigt, entwürdigt und entmenschlicht wurde, vergessen ist?“
Ein solches Erinnern aus dem Glauben an einen mitleidenden Gott wisse auch um die dunklen Seiten Gottes, die nicht einfach erklärt werden könnten. Der Schrei des Gottessohnes am Kreuz „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ sei nicht unmittelbar beantwortet worden. Die Frage des Karfreitags treffe sich mit so vielen Fragen der Menschen in Verzweiflung und Angst.
„Seitdem können wir mit unseren furchtbaren offenen Fragen leben – in der Hoffnung, daß sie im Licht des Ostermorgens beantwortet werden.“ Christliches Erinnern lebe letztlich aus der Hoffnung, daß nur Gott selbst die Tränen abwischen könne und daß nur ER selbst am Ende Richter sei. „Es ist jene Hoffnung, die uns heißt, den Blick auf den Gekreuzigten zu richten – trotz allem.“
Es stelle sich auch der katholischen Kirche die Frage von Mitverantwortung, so der Bischof weiter. Das Schuldbekenntnis der Kirche, vor aller Welt am 12. März 2000 von Papst Johannes Paul II. ausgesprochen, enthalte auch das „Schuldbekenntnis im Verhältnis zu Israel“: „Laß die Christen der Leiden gedenken, die dem Volk Israel in der Geschichte auferlegt wurden. Laß sie ihre Sünden anerkennen, die nicht wenige von ihnen gegen das Volk des Bundes und der Verheißung begangen haben.“
Während seiner anschließenden Pilgerreise nach Israel habe der Papst am 23. März 2000 in der Gedenkstätte Yad Vashem dieses Bekenntnis vertieft und es dann symbolkräftig an der Klagemauer hinterlegt: „Als Bischof von Rom und Nachfolger des Apostels Petrus versichere ich dem jüdischen Volk, daß die katholische Kirche, motiviert durch das biblische Gesetz der Wahrheit und der Liebe und nicht durch politische Überlegungen, tiefste Trauer empfindet über den Haß, die Verfolgungen und alle antisemitischen Akte, die jemals irgendwo gegen Juden von Christen verübt wurden. Die Kirche verurteilt Rassismus in jeder Form als eine Leugnung des Abbildes Gottes in jedem menschlichen Wesen.“
Diese Symbole der Versöhnung von Papst Johannes Paul II. seien zu einer Quelle der Erneuerung geworden. Am 15. Januar 2005 hatte der Papst in seiner Botschaft zum 60. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz gesagt: „Dieser Versuch, ein ganzes Volk planmäßig zu vernichten, liegt wie ein Schatten über Europa und der ganzen Welt; es ist ein Verbrechen, das für immer die Geschichte der Menschheit befleckt. Heute zumindest und für die Zukunft gelte dies als Mahnung: Man darf nicht nachgeben gegenüber den Ideologien, die die Möglichkeit rechtfertigen, die Menschenwürde aufgrund der Verschiedenheit von Rasse, Hautfarbe, Sprache oder Religion mit Füßen zu treten.“ (bpf)