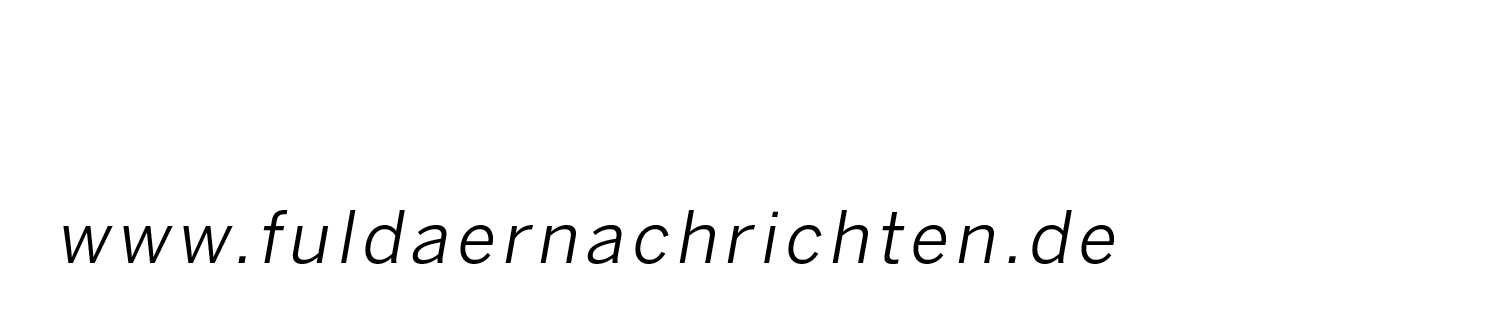Rhön/Berlin/Kopenhagen. Die Verantwortlichen deutscher Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks hoffen auf mehr Unterstützung von Politik und Wirtschaft, um bestehende Klimaschutzmaßnahmen in den Nationalen Naturlandschaften zu erhalten und neue Projekte zu realisieren. Deutschland könnte durch die Umsetzung dieser Projektwünsche seine Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz ausbauen, meinen auch die Leiter der Verwaltungsstellen des Biosphärenreservats Rhön.
Rhön/Berlin/Kopenhagen. Die Verantwortlichen deutscher Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks hoffen auf mehr Unterstützung von Politik und Wirtschaft, um bestehende Klimaschutzmaßnahmen in den Nationalen Naturlandschaften zu erhalten und neue Projekte zu realisieren. Deutschland könnte durch die Umsetzung dieser Projektwünsche seine Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz ausbauen, meinen auch die Leiter der Verwaltungsstellen des Biosphärenreservats Rhön.
Das Ziel für die 15. UN-Klimakonferenz, die vom 7. bis 18. Dezember in Kopenhagen stattfindet, ist klar: die globale Reduktion der Treibhausemissionen. In den Nationalen Naturlandschaften vom Watzmann bis zum Wattenmeer werde seit Jahren Klimaschutz betrieben. Dabei könnte man noch viel mehr machen, meinen die Verantwortlichen der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks. Sie wollen mehr finanzielle und sachliche Unterstützung von Politik und Wirtschaft, äußerten sie jetzt gegenüber Europarc Deutschland, der Dachorganisation der deutschen Biosphärenreservate, National- und Naturparke mit Sitz in Berlin.
Die Wunschliste derer, die wie kaum andere den Klimaschutz in Deutschland aktiv umsetzen, ist lang und reicht von einer Erhöhung der personellen Ausstattung in den Parkverwaltungen, hin zu direkten Schutzmaßnahmen durch das Pflanzen von Klimaschutzwäldern, der Umwandlung in „Null-Emissions-Regionen“ und den Erhalt von Moorflächen. Die auf regionaler Ebene existierenden Klimaprogramme müssten erhalten, ausgebaut und länderübergreifend einsetzbar werden.
„Studien belegen, dass die ökologische Landwirtschaft deutlich klimafreundlicher ist als die gute fachliche Praxis. Gleichwohl fehlt es an effizienten Beratern und Programmen. Biosphärenreservate bieten sich an, modellhaft neue Wege in der Beratung der landwirtschaftlichen Betriebe zu beschreiten und diese durch geeignete Fördermaßnahmen zu unterstützen“, sagt beispielsweise der Leiter der Hessischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön, Otto Evers.
Gleichzeitig setzt sich Evers für eine Förderung der regionalen Produkte, insbesondere im Lebensmittelsegment, ein. Damit würden lange Transportwege und somit auch CO2 Emmissionen vermieden. „Regionale Produkte, hergestellt in kleinen Produktionsstätten, erhalten Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfungsketten in den ländlichen Gebieten. Die Realisierung vieler innovativer Ideen scheitert aber oft an behördlichen Auflagen, die auf Großbetriebe zugeschnitten sind“, mahnt der Leiter der hessischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön an.
Regionale Produkte stehen für kurze Transportwege und damit für weniger CO2 Emmissionen. Im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön haben solche Produkte einen hohen Stellenwert. Unter anderem wirbt der „Rhöner Wurstmarkt“ in Ostheim alle zwei Jahre für die Herstellung traditionell erzeugter Wurstwaren.
Der Sachgebietsleiter Biosphärenreservat beim Landkreis Fulda, Martin Kremer, weist auf die enormen Pendlerströme hin, die sich Tag für Tag aus den ländlichen Regionen in die Ballungszentren wälzen. Allein aus der hessischen Rhön seien täglich über 20 000 Pendler unter anderem bis in das Rhein-Main-Gebiet unterwegs. „Im Sinne des Klimaschutzes erarbeitet das Biosphärenreservat Rhön zurzeit als Pilotprojekt eine ‚Digitale Mitfahrzentrale’ für die Gesamtkulisse des Mittelgebirges Rhön unter Einbeziehung der umliegenden Zentren. Nach Bestätigung der Praxistauglichkeit sollten derartige Mitfahrzentralen für alle ländlichen Regionen Deutschlands vorgesehen werden“, regt Kremer an.
Als weiteren Schwerpunkt beim Klimaschutz nennt der Sachgebietsleiter die Wasserkraft, die bei der Diskussion um den Ausbau der regenerativen Energien offensichtlich bundesweit aus dem Blickwinkel der Klimapolitik verschwunden sei. Gerade im Alpenraum und in den Mittelgebirgen gebe es erhebliche Ausbaupotentiale für eine klimaneutrale Energieerzeugung an volkswirtschaftlich sinnvollen Standorten durch Wasserkraft.
„Nach einem mehr als hundertjährigen Sterben der Mühlen und Wasserkraftanlagen ist eine Trendwende erforderlich. Insbesondere sind Erleichterungen in den Genehmigungsverfahren sowie Rechtssicherheit für die Betreiber nötig“, sagt Kremer. Würde sich nach Ansicht des Leiters der Thüringer Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön, Karl-Friedrich Abe, als CO2 Senke positiv auswirken: eine Erhöhung des Kernzonenanteils.
„Wir benötigen die Erhöhung des Kernzonenanteils in Biosphärenreservaten auch als CO2 Senke“, erklärt der Leiter der Thüringer Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön, Karl-Friedrich Abe. Durch weiteren Flächenankauf könnte seiner Meinung nach auch die Wiedervernässung ehemaliger Feuchtgebiete als CO2 Senke eingeleitet werden. „Und eine Finanzierung von Werkverträgen würde Forschung und Monitoring im Biosphärenreservat ermöglichen, um die Indikatoren zu Klimaänderungen und –folgen in der Rhön deutlich zu erkennen“, ergänzt Abe.
„CO2 Einsparung muss meiner Ansicht nach beim wichtigsten Emittenten ansetzen, und das sind wir alle. Gelegenheiten dazu gibt es unzählige“, sagt der Leiter der bayerischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön, Regierungsdirektor Michael Geier. Beispielsweise spare der gezielte Einkauf regionaler Produkte nicht nur Transportkilometer; er erhöhe auch die regionale Wertschöpfung. Am Qualitätssiegel Rhön als Bestandteil der Dachmarke Rhön seien solche Produkte jederzeit erkennbar.
„In unserem bayerischen Teilprojekt zum Bundesförderprojekt ,Klimaschutz und Klimawandelanpassung in deutschen Biosphärenreservaten‘ versuchen wir außerdem, weit über die üblichen Energiegutachten im öffentlichen Bereich hinauszugehen und in einzelnen Modellgemeinden möglichst viele Privathaushalte zum Mitmachen zu bewegen. Der Rhöner Energiecheck vor einigen Jahren hat gezeigt, dass das wirtschaftliche lohnende Potential für Energiesparmaßnahmen enorm groß ist. Wir hoffen, dass sich die Rhöner beim Geldsparen helfen lassen wollen“, hebt Geier hervor.