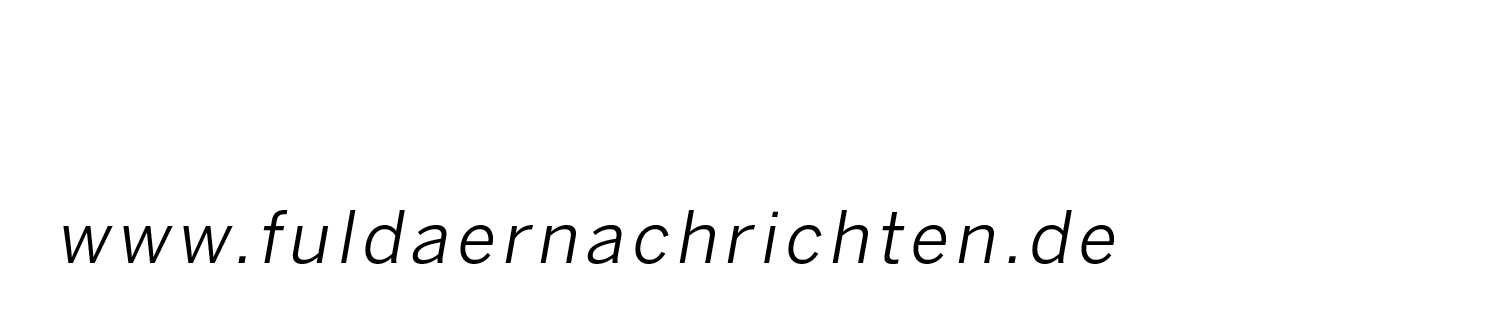Rhön. Auf Einladung der Biosphärenreservates Rhön referierte Peter Rothe, emeritierter Geologie-Professor der Universität Mannheim, über die vulkanische Vergangenheit der Rhön in der Gaststätte Hasenmühle in Tann. Rothe machte deutlich, dass nach jüngsten wis-senschaftlichen Untersuchungen in der Zeit vor 25 bis 15 Millionen Jahren gewaltige vulkanische Prozesse in der Rhön stattfanden. Dabei legte er vor allem das Augenmerk auf die hessische Rhön. Heute besteht die Rhön überwiegend aus Vulkanruinen.
Rhön. Auf Einladung der Biosphärenreservates Rhön referierte Peter Rothe, emeritierter Geologie-Professor der Universität Mannheim, über die vulkanische Vergangenheit der Rhön in der Gaststätte Hasenmühle in Tann. Rothe machte deutlich, dass nach jüngsten wis-senschaftlichen Untersuchungen in der Zeit vor 25 bis 15 Millionen Jahren gewaltige vulkanische Prozesse in der Rhön stattfanden. Dabei legte er vor allem das Augenmerk auf die hessische Rhön. Heute besteht die Rhön überwiegend aus Vulkanruinen.
Das, was heute an vulkanischem Gestein z. B. im Kegelspiel zu sehen ist, ist meist unter der damaligen Erdoberfläche abgekühlt und erst im Laufe der Jahrmillionen durch Erosion freigelegt worden. Eine Besonderheit stellen Wasserkuppe und die Lange Rhön dar. Die Wasserkuppe ist kein Vulkan in der klassischen Kegelform. Dies liegt daran, dass hier extrem heiße und dünnflüssige Laven aus einer Tiefe von etwa 100 km aus dem Erdinnern herausgefördert wurden und sich breitflächig verteilten.
Dies geschah im Wechsel mit der Ausschüttung von Lockermaterial und Aschen, sodass heute noch ein treppenförmiger Aufbau der Wasserkuppe erkennbar ist. Von der großen Hitze, die bei der Entstehung der Wasserkuppe herrschte, zeugt das am Fliegerdenkmal zu findende Mineral Olivin im Basalt, das aus der Schmelze schon bei 1700° C kristallisiert war. Heute ist die Wasserkuppe nur noch ein Erosionsrest eines weitläufigen Basaltausflusses, der sich möglicherweise aus langen Spalten ergoss. Anders wird die Entstehung der Milseburg interpretiert.
Zwar erinnert die Form an einen Vulkan, gleichwohl ist der heutige Berg nur der Erosionsrest aus der Wurzel eines Vulkans. Professor Rothe deutete an, dass die Milseburg im Zusammenhang mit einer Caldera stehen könnte, eines durch starke Explosionen entstandenen Vulkankraters. Als Belege verweist der Professor auf fest miteinander „verbackenes“ Gesteinsmaterial aus völlig unterschiedlichen Erdzeitaltern und Tiefen, welches durch eine außergewöhnlich explosive vulkanische Tätigkeit an die Erdoberfläche gefördert wurde.
Auch die Ergebnisse von Kernbohrungen, die vom Hessischen Landesamt für Bodenforschung am Rande der Milseburg durchgeführt wurden, dokumentieren eine explosive Rhöner Vergangenheit: chaotisch durcheinander gewürfelte Untergründe, Schuttströme, Ascheschichten und Schmelztuffe. Der Professor zieht zur Verdeutlichung den Vergleich mit der Eruption des Mount St. Helens 1980 in den USA, bei der nahezu der gesamte ursprüngliche Vulkankegel „weggesprengt“ wurde.
Die Entstehung der Steinwand führt der Geologe auf einen tektonischen Riss, wie die Rhönlandschaft viele aufweist, zurück. In diese Bruchspalte drang vor Jahrmillionen Lava, füllte den Riss und das entsprechende Gestein wurde im Laufe der Zeit aus dem weicheren und älteren Rahmengestein herausmodelliert. Otto Evers, Leiter der Hessischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservates, dankte Prof. Rothe für seine anschaulichen Ausführungen und verwies darauf, dass es gerade die vulkanische Vergangenheit der Rhön ist, die heute die Förderung von herausragen-dem Mineralwasser erst möglich macht. Für das Biosphärenreservat ist es Länder über-greifend ein wichtiges Ziel, die vielfältigen Zeugnisse der geologischen Vergangenheit im Projekt „Rhöner Geologie“ in Wert zu setzen, zu dokumentieren und erlebbar zu ma-chen.