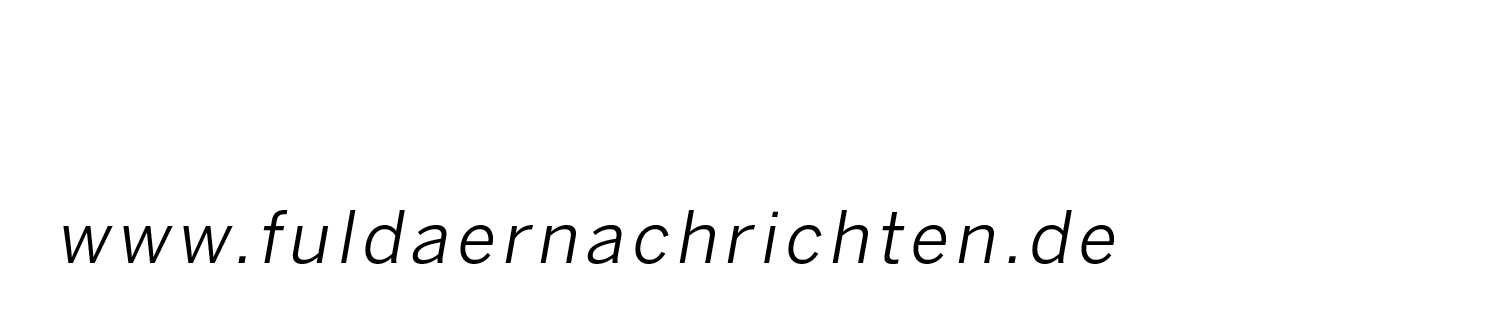Wasserkuppe. Für die Ausweisung von weiteren Kernzonen im hessischen Teil des Biosphärenreservats Rhön bieten sich Grenzertragsflächen in Waldgebieten an, auf denen keine normale forstwirtschaftliche Nutzung mehr stattfindet. Aus naturschutzfachlicher Sicht sollten diese Fläche eine Mindestgröße von fünfzig Hektar haben, damit ein vielfältiges Lebensraummosaik entwickeln kann, das ein Höchstmaß an Artenvielfaltermöglicht.
Eine Gesprächsrunde auf Einladung von Landrat Bernd Woide mit Vertretern der Land- und Forstwirtschaft sowie der Kommunen im Groenhoff-Haus war sich einig, dass solche Flächen eigentlich nur im Staatsforst oder bei großen Privatwaldbesitzern zur Verfügung stünden.
Einleitend machte Landrat Woide deutlich, dass die Weiterentwicklung des Biosphärenreser-vats im breiten regionalen Konsens erfolgen müsse. Dabei dürften weder die Landwirtschaft noch die Forstwirtschaft vor den Kopf gestoßen werden, weil diese als entscheidende Träger der Kulturlandschaft diese zu dem gemacht hätten, was sie heute sei und seinen Niederschlag in der Aufwertung zum Biosphärenreservat der UNESCO gefunden habe.
Trotz an-fänglicher Skepsis stehe die Bevölkerung heute voll hinter der Philosophie des Biosphärenreservats. Deshalb sollte die Ausweisung zusätzlicher Kernzonen „nicht unreflektiert und losgelöst von den Interessen der Menschen im ländlichen Raum erfolgen“.
Sinnvolles mit Nützlichem verbinden
Dr. Hubert Beier, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes und des Waldbesitzerverban-des, wies auf die bedeutende Rolle der Land- und Forstwirtschaft als Rohstofflieferanten im Bereich von Nahrungsmittelproduktion und Energieerzeugung hin. Bei der Ausweisung zusätzlicher Kernzonen gehe es darum, „Sinnvolles mit Nützlichem zu verbinden“.
Dr. Baier sieht vor allem das Land in der Pflicht, geeignete Flächen über HESSEN-FORST zur Verfügung zu stellen. Lothar Röder betonte als Vorsitzender des Kreisbauernverbandes, dass „unsere Vorfahren mit der Arbeit ihrer Hände die Kulturlandschaft Rhön geschaffen haben“. Auch vor diesem Hintergrund sollte Naturschutz „angemessen“ bleiben.
Christof Müller, Vorsitzender des Waldbesitzerverbandes, kann sich Kernzonen auf schwer zu bewirtschaftende Grenzertragsstandorten im Wald vorstellen. Eine Möglichkeit sei auch, forstlich minderwertige Altbestände dem natürlichen Entwicklungskreislauf zu überlassen. Aber auch dafür müsse die Frage der Nutzungsentschädigung geregelt werden.
„Wenn nicht mit Fingerspitzengefühl vorgegangen wird, schwindet die Akzeptanz des Biosphärenreservats.“ Otto Evers, Leiter der hessischen Verwaltungsstelle, sprach sich gegen ein „Zusam-menkratzen von Kleinstflächen“ aus, um auf die geforderten drei Prozent Kernzone zu kommen. Durch die Anrechnung von Nutzungsaufgaben als vorgezogene Naturschutzersatzmaßnahmen könne ein finanzieller Ausgleich erreicht werden.
In der Gesprächsrunde herrschte Einvernehmen, dass die Zeit bis zur erneuten Evaluierung des Biosphärenreservats im Jahr 2013 genutzt sollte, um bei der Ausweisung von zusätzli-chen Kernzonen nach Lösungen zu suchen, die aus naturschutzfachlicher Sicht zielführend seien und von den betroffenen Grundstückseigentümern mitgetragen würden.
„Dabei dürfen wir das Land nicht aus der Verantwortung entlassen“, mahnte Dr. Beier auch in seiner Funk-tion als Vorsitzender des Vereins Natur- und Lebensraum Rhön. Die Gemeinde Poppenhausen habe bereits ein konkretes Projekt vor Augen, berichtete Bürgermeister Manfred Helfrich. Hier gehe es um sieben Hektar mit einem 160-jährigen Buchenbestand.
Gewachsene dörfliche Strukturen erhalten
Manfred Helfrich zeigte mit seinem Bürgermeisterkollegen Hubert Blum aus Hilders den Zwiespalt auf, in dem sich die Gemeinden bei ihrer Bauleitplanung auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels befänden. Einerseits seien Neubaugebiete notwendig, um gewachsene dörfliche Strukturen zu erhalten, andererseits gehe häufig damit ein Flächenverbrauch einher.
Am besten wäre es, die zunehmend leerstehende Anwesen in den Ortskernen für Wohnzwecke auszubauen. Allerdings stelle sich immer die Frage nach der Verfügbarkeit der Gebäude. Deshalb plädierte Bürgermeister Helfrich dafür, die weggefallene Eigenheimzulage durch ein Förderprogramm Bauen im Ortskern zu ersetzen.