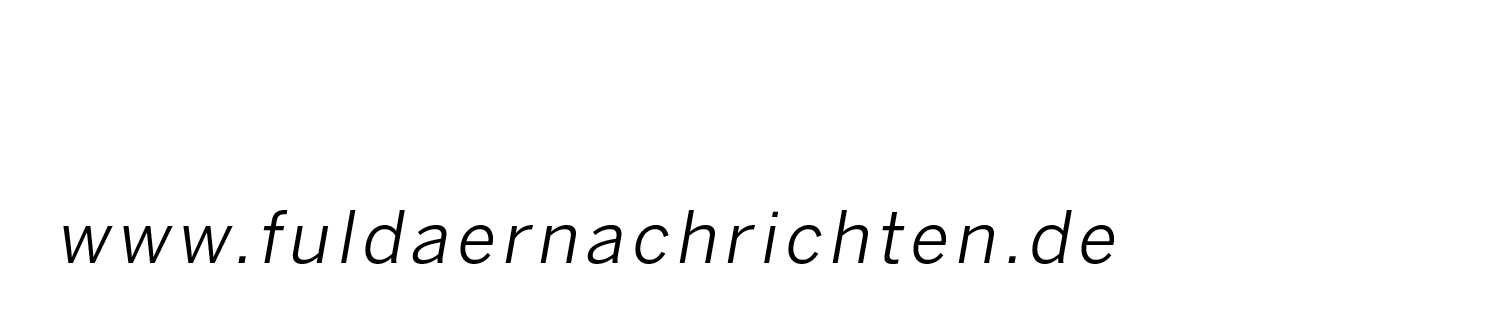Fulda. „Das ist das Besondere der Theologie, daß sie sich dem zuwendet, was wir nicht selbst erfunden haben und was uns gerade dadurch Fundament des Lebens sein kann, daß es uns vorausgeht und uns trägt, also größer ist als unser eigenes Denken.“ Dies betonte Weihbischof Prof. Dr. Karlheinz Diez am Freitag in Fulda zum Abschluß der traditionellen Hrabanus-Maurus-Akademie, des Patronatsfestes der Theologischen Fakultät Fulda.
Der Weihbischof sprach in Vertretung des Großkanzlers, Bischof Heinz Josef Algermissen, das Schlußwort im Auditorium maximum und erinnerte an die Aufforderung aus dem ersten Petrusbrief: „Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt.“
Dieses Wort sage viel über Inhalt und Aufgabe und über den Dienst des Theologen aus. Hoffnung. „Darum geht es in einem tiefen Sinn in der Theologie: Unsere Hoffnung lebt von der Erinnerung und der Verheißung. Wir entwerfen sie nicht selbst. In der Erinnerungsgemeinschaft der Kirche vergewissern wir uns des Evangeliums.“
In seinem Schlußwort betonte Weihbischof Diez, daß die christliche Hoffnung nicht ein unbestimmtes Gefühl sei, sondern einen Grund habe, der der Vernunft zugänglich sei. „Dieser Vernünftigkeit, diesem Logos unserer Hoffnung nachzuspüren ist Aufgabe der theologischen Wissenschaft. Deshalb hat die Theologie als Wissenschaft mit Recht einen ihr eigenen Ort innerhalb der Universitas der Wissenschaften als Theologische Fakultät.“
Die Theologie bemühe sich, die Hoffnung des Evangeliums ins Wort zu heben. Sie deute die Sprache, in der den Menschen Hoffnung und Verheißung überliefert seien. Dabei könne sich der Theologe persönlich nicht heraushalten, sondern müsse, mit solider theologischer Ausbildung ausgestattet, Zeuge des Glaubens werden im Bezug zu den Menschen. „Das Zeugnis schließt Information und Argumentation ein, erschöpft sich aber nicht darin“, unterstrich Diez.
Dem Theologiestudium stehe heutzutage durch Modularisierung und Interdisziplinarität sozusagen „ein neues Design“ bevor. „Ich wünsche mir, daß bei der Suche nach dem neuen Theologiedesign die Leidenschaft für das Geheimnis Gottes und den ‚Deus semper maior’ (‚immer größeren Gott’) und daher auch für das theologische Nachdenken, nicht verflache möge.“ Der Theologe Erich Przywara, mit dem sich der akademische Vortrag von Kaplan Florian Böth beschäftigte, bleibe darin ein ernster Mahner.
Weihbischof Diez nahm hiermit auf den akademischen Vortrag mit dem Titel „Mensch zwischen Mann und Frau – Anmerkungen zur Theologie der Geschlechter“ bezug, den Kaplan Böth aus seiner Diplomarbeit bei Weihbischof Diez, der von 1998 bis 2006 als Professor an der Fakultät wirkte, entwickelt hatte. „Sie haben Mut bewiesen, eine Arbeit über Erich Przywara zu schreiben“, so der Weihbischof, denn dieser gelte zwar einerseits als hoch angesehener Theologe, zeichne sich aber durch eine sehr „dornige“ Sprache aus.
Festvortrag über Theologie der Geschlechter nach Erich Przywara
Zu Beginn der Festakademie hatte Rektor Prof. Dr. Richard Hartmann Weihbischof Diez, Weihbischof Johannes Kapp, die anwesenden Domkapitulare und Professoren sowie zahlreiche weitere Gäste begrüßt. Hartmann wies darauf hin, daß in dieser Woche für die Theologie und die Fuldaer Fakultät wichtige Themen behandelt worden seien, zum einen beim Fakultätentag in Erfurt die Probleme des Priesternachwuchses und die Rolle der Theologie in der Öffentlichkeit, zum anderen bei der Fuldaer Fakultätskonferenz die neue Studienordnung. In seinem Vortrag ging Florian Böth auf die „Theologie der Geschlechter“ ein, wie sie der Theologe Erich Przywara (1889-1972) in seinem umfangreichen Werk entwickelte.
Die Geschlechtlichkeit des Menschen als Frau oder Mann gehöre in der katholischen Theologie zum Wesen des Menschen. Im Gegensatz zu Modellen, in denen von einer Unterordnung der Frau unter den Mann ausgegangen oder der Mensch als „mann-weibliches Wesen“ gesehen wird, strebe laut Böth der profilierte Theologe Przywara auf der Basis der auf dem Kreuz Christi beruhenden Heilsgeschichte keine vorschnelle Harmonisierung an, sondern sehe ein „rhythmisches Gegenüber und Zueinander zum jeweils anderen“ im Verhältnis von Mann und Frau, ohne die Unterschiede zu verwischen.
Für den Theologen sei die Geschlechtlichkeit durch den Schöpfer vorgegeben, wobei der Grund hierfür außerhalb des dem Menschen Zugänglichen liege, nämlich im „unbegreiflichen Gott“. Wenn schon Gott unbegreiflich und der Mensch bei aller Unähnlichkeit dennoch sein Abbild sei, dann könne das Geheimnis des Menschen nicht vollständig geklärt werden.
„All die Rätselhaftigkeit, die die Geschlechterdifferenz dem Menschen bietet, trägt letzten Endes also dazu bei, als Mann oder Frau am Geheimnis Gottes teilhaben zu können“, so Böth. Somit integriere Przywara mit seiner Auffassung den biblischen Beitrag und betrachte die Beziehung zwischen Mann und Frau differenzierter als andere Sichtweisen. Das Geheimnis Gottes sei dann die eigentliche Antwort auf die Frage nach dem Geheimnis des Menschen und seiner Geschlechtlichkeit.
Verleihung des Eduard-Schick-Preises an Jürgen Kämpf
Weihbischof Diez gratulierte dem Diplomtheologen Diakon Jürgen Kämpf (zur Zeit Stadtallendorf-Niederklein) zur Verleihung des Eduard-Schick-Preises und erinnerte an den unvergessenen Fuldaer Bischof, dessen Namen der Preis trägt. Kämpf erhielt den mit 1.500 Euro dotierten Preis für seine herausragende Leistungen in der Diplomprüfung und seine Diplomarbeit mit dem Titel „Der Zölibat als eine mögliche Form der reinen Liebe“.
Rektor Hartmann wies in diesem Zusammenhang auf die Botschaft einer solchen Auszeichnung: einerseits als Vorbild für die Studenten, andererseits als Aufruf an die Verantwortlichen zur Nachwuchsförderung. Diez dankte sodann im Namen des Großkanzlers den akademischen Lehrern für das hohe Niveau der Fakultät. Die Akademieveranstaltung wurde musikalisch umrahmt durch das Ensemble von Ludmila und Maria Langenstein (Mandoline) und Lothar Ebert (Gitarre).