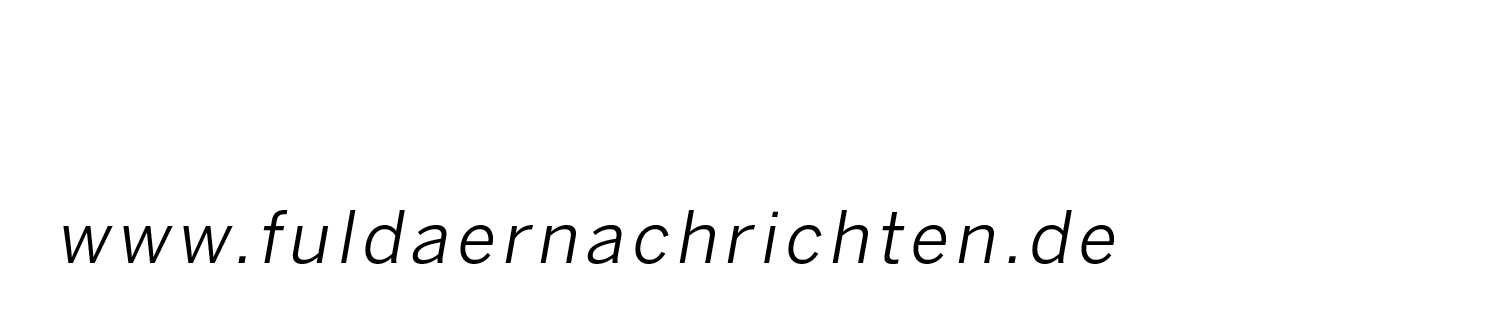Fulda. Markus Sterr und Sandra Poschman vom Deutschen Entwicklungsdienst (DED) referierten beim Fuldaer Abend der Hochschule zum Thema “Entwicklungszusammenarbeit und Kultur”. Der Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften empfing mit ihnen zwei Praktiker aus der Entwicklungszusammenarbeit. Die Referenten konnten reiche persönliche Erfahrungen in ihren Vortrag einfließen lassen – und machten die Zuhörer bekannt mit Problemfeldern der Entwicklungszusammenarbeit aus so unterschiedlichen Regionen der Welt wie Mali, Ecuador oder Jemen.
Fulda. Markus Sterr und Sandra Poschman vom Deutschen Entwicklungsdienst (DED) referierten beim Fuldaer Abend der Hochschule zum Thema “Entwicklungszusammenarbeit und Kultur”. Der Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften empfing mit ihnen zwei Praktiker aus der Entwicklungszusammenarbeit. Die Referenten konnten reiche persönliche Erfahrungen in ihren Vortrag einfließen lassen – und machten die Zuhörer bekannt mit Problemfeldern der Entwicklungszusammenarbeit aus so unterschiedlichen Regionen der Welt wie Mali, Ecuador oder Jemen.
Der Deutsche Entwicklungsdienst arbeitet seit 1963 in der ‚Entwicklungszusammenarbeit’. Im Zuge einer Orientierung weg von einseitiger Hilfe hin zu Kooperation mit dem Entwicklungsland ersetzte dieser Begriff denjenigen der ‚Entwicklungshilfe’. Der Verband entsendet momentan ca. 1000 Entwicklungshelfer in 45 Länder.
Kultur und Entwicklung hingen stark zusammen, Kultur beeinflusse wirtschaftliches Verhalten – und Entwicklungszusammenarbeit sei immer Einmischung in Kultur, betonte Markus Sterr. Eine Studie vom Beginn der 90er Jahre habe aber aufgezeigt, dass 50 Prozent der zu dieser Zeit vom DED geförderten Projekte spezifische sozioökonomische, politische oder eben kulturelle Gegebenheiten in den Projektländern ignorierten. In seinem Vortrag erläuterte Sterr anhand von Praxisbeispielen, wie der Aspekt der Kultur in den letzten Jahren stärker in die Arbeit in Entwicklungsländern einfließe.
Er sprach zum Beispiel über den Erhalt traditionellen Handwerks im Niger oder Straßentheater zum Thema Gewalt in Ecuador. Interkulturelle Problemfelder müssten neu definiert werden. „Der DED arbeitet dialogorientiert“, sagte Sterr, der in Bonn, dem Sitz des DED, als Fachreferent für Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung tätig ist und selbst lange als Entwicklungshelfer in Ghana und Ecuador arbeitete.
Sandra Poschmanns Beitrag bot noch mehr Einblicke in die Praxis und die interkulturellen Aspekte der Entwicklungszusammenarbeit. Sie brachte frische Erfahrungen aus einem Kulturprojekt in der Stadt Sana’a in Jemen mit, aus dem sie erst vor zwei Monaten zurückgekehrt ist. Anschaulich stellte sie dar, wie sich soziale und kulturelle Tradition in der historischer Bausubstanz im alten Stadtkern spiegele, und wie die Einzug haltende Moderne diese Strukturen verändere.
Die Architektin und Denkmalpflegerin arbeite über zwei Jahre lang mit am Erhalt des historischen Zentrums der Stadt, das als UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnet wurde. Diese Arbeit am traditionellen „Gesicht der Stadt“ sei auch eine Arbeit für die Menschen vor Ort, indem sie deren kulturelle Wurzeln erhalte und Lebensbedingungen verbessere, so Poschmann.
Im Anschluss an den Vortrag mussten sich die Referenten den kritischen und kompetenten Fragen des Publikums stellen. Für die Professoren und Studierenden des Fachbereichs war der Abend ein sowohl örtliches als auch inhaltliches Heimspiel – beschäftigen sich doch sowohl der Bachelorstudiengang „Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt interkulturelle Beziehungen“ als auch der Masterstudiengang „Intercultural Communication and European Studies“ intensiv mit dem Thema der interkulturellen Kommunikation und mit Projektmanagement im globalen Kontext. Die Veranstaltung – einer der „eher punktuellen Berührungspunkte“ der Praktiker mit der Wissenschaft, wie Sterr erklärte – trug so für Referenten wie Publikum Früchte.
Der nächste Fuldaer Abend findet erst im Frühjahr zum nächsten Semester statt. Termine und Inhalte werden frühzeitig veröffentlicht. Die Bilanz dieses Semesters lässt auf Interessantes hoffen.