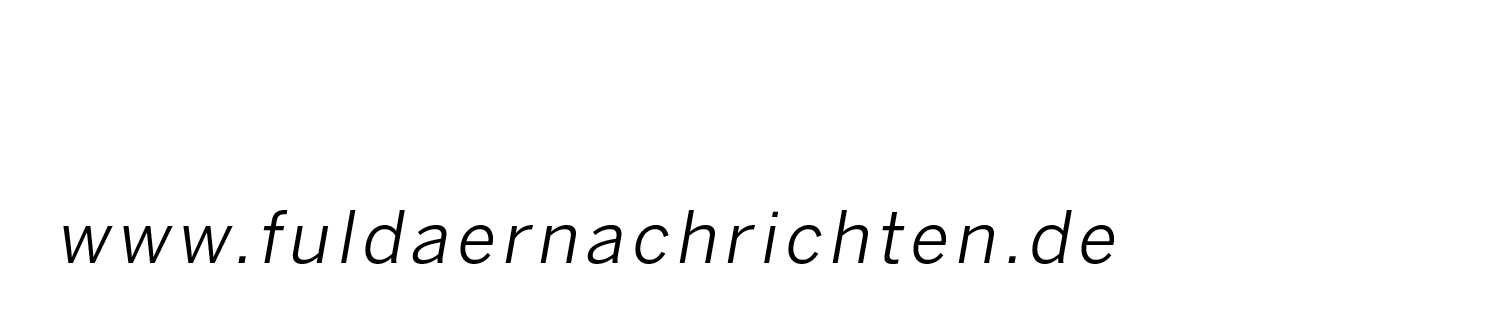Schönes aus Fulda. Zum ersten Hessischen Palliativtag hatte am vergangenen Samstag die Landesarbeitsgemeinschaft Palliativversorgung Hessen (LAPH) nach Fulda eingeladen. Zentrales Thema der Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Roland Koch war die ambulante Palliativversorgung in der Altenpflege.
Fazit der rund 250 Gäste aus allen medizinischen Berufsgruppen: Palliatives Denken etabliert sich. Politik, Kostenträger und Verbände wissen um die Bedeutung. Gerade in Geriatrie und Altenpflege sei dieser Versorgungsbereich essentiell. Allerdings läge enormes Potential im Bereich Qualifizierung. Auch müssen die Rahmenbedingungen verbessert und die Finanzierungsmöglichkeiten angepasst werden.
Seit dem 1. April dieses Jahres hat jeder Deutsche im Bedarfsfall ein Recht auf eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung am Lebensende – das soll die Gesundheitsreform der Bundesregierung garantieren. So möchte die hessische Landesregierung vorhandene, funktionierende Strukturen erhalten und unterstützen, überflüssige neue Strukturen vermeiden – denn derzeit sterben nur ein Drittel der Menschen zu Hause, obwohl über 80 Prozent den Wunsch dazu haben.
Palliativmedizin versorgt unheilbar Kranke bis ans Lebensende
Auch soll es einen Hospiz- und Palliativbeauftragten geben, der parteiunabhängig im Auftrag der Landesregierung agieren wird. Die regionalen Gesundheitsämter initiieren und organisieren in regelmäßigen Abständen einen Austausch aller Interessenvertreter. Die so genannte Palliativmedizin versorgt Menschen mit unheilbaren Erkrankungen am Lebensende und setzt da an, wo herkömmliche Maßnahmen enden. Es wird das behandelt, was sinnvoll ist, um dem Patienten die bestmögliche Lebensqualität zu geben.
„Wer heute über Palliativversorgung spricht, denkt an Krebspatienten“, sagt Thomas Sitte, Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Palliativversorgung Hessen und Mitglied im Palliativnetz Osthessen. Tatsächlich bilden diese mit über 90 Prozent die größte Gruppe derer, die palliativ betreut werden. „Allerdings leiden zwei Drittel der Patienten zum Großteil altersbedingt an Demenz, Herz-, Kreislauf-, oder Stoffwechselerkrankungen – werden aber nur in geringem Maße versorgt.“
„Das Potenzial in der Altenpflege ist immens“,
Doch gerade hier ist Palliativversorgung von Nöten, denn die hauptsächlichen Symptome wie Schmerz, Atemnot, Erbrechen oder Schlaflosigkeit können ambulant behandelt werden. „Das Potenzial in der Altenpflege ist immens“, erklärt Dr. Thomas Schindler von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. „Aber hier sind ganz spezielle Qualifikationen von Nöten, für die es bisher eine spezielle Ausbildung gab.“ In der Palliativen Versorgung wird nicht nur die medizinische Betreuung abdeckt, Gespräche über die ganz persönliche Lage, Gefühle, Hoffnungen und Befürchtungen im Umgang mit der Erkrankung sind für Betroffene und Angehörige gleichermaßen wichtig.
„In Deutschland investiert man in die Akutversorgung, aber nicht in Palliative Maßnahmen“, sagt Schindler. „In Norwegen arbeitet man im Pflegebereich mit der doppelten Personalstärke, hat aber keine höheren Kosten im Gesundheitswesen – im Gegenteil. Für die individuelle Symptomkontrolle und Betreuung sind viel Erfahrung und spezielle Kenntnisse elementar.“
Palliativversorgung akzeptiert die Unheilbarkeit
Allerdings sei Deutschland hier anders ausgerichtet, wie Dr. Wolfgang Spuck, der zweite Sprecher Landesarbeitsgemeinschaft für Palliativversorgung Hessen (LAPH) erklärt: „Wir verstehen uns als Reparaturbetrieb. Ziel ist dabei die Heilung – wenn diese nicht mehr möglich ist, bedeutet das für die Medizin eine Niederlage.“ Palliativversorgung akzeptiert die Unheilbarkeit und begleitet den Patienten auf seinem Weg bestmöglich, um die verbleibende Zeit mit Leben zu füllen.
Für den Mediziner ist es oftmals eine Gratwanderung von dem Punkt erkannt zu haben, dass das Sterben beginnt, bis dahin auch den Mut zu haben, das entsprechende Behandlungsziel neu zu definieren. „Von Gesetz wegen muss der Arzt den Patienten so lange er kann behandeln, sonst ist das unter Umständen unterlassene Hilfeleistung“, sagt Prof. Günter Baust, Mitglied der Akademie für Ethik in der Medizin. „Für unnütze Behandlungen gibt es keinen Richter – diese können immer begründet werden.“
Versorgung Älterer wird immer wichtiger
Der Bereich der Pflege nimmt in der Versorgung Älterer einen immer wichtigeren Stellenwert ein. „Im Bereich Geriatrie tut sich einiges. Aufgrund der demographischen Entwicklung werden wir in den kommenden Jahren vermehrt pflegebedürftige Menschen haben“, erklärt Dr. Matthias Pfisterer, Chefarzt für Altersmedizin und Palliativmedizin. Die typischen Diagnosen benennt er mit Schmerz, Hör- oder Sehverlust, Verwirrtheit und Abhängigkeit. Dazu kommt, dass in Hessen derzeit jeder zweite Haushalt ein Einzelhaushalt sei. „Spätestens mit 80 können die Menschen in der Regel ihren Alltag nicht mehr allein bestreiten und sind auf Hilfe angewiesen.“
Eine effektive Versorgung ist nur im Team möglich: sprich nur dann, wenn sich alle beteiligten Gruppen, wie Angehörige, Ärzte, Hospizhelfer, Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Psychologen, Seelsorger, Sozialarbeiter und andere zusammen zum Wohl des Patienten engagieren. „Zunächst geht es darum zuzuhören, was der Patient möchte“, erklärt Sandra Schmitt vom Pflegedienst Sonnenblume. „Dann stellt sich die Frage, was das soziale Umfeld leisten kann.“„Dabei ist Empathie ganz wichtig“, ergänzt Marion Hennemann-Wagner von der Klinik Merxhausen. „Es gilt sich selbst zurückzunehmen, eigene Erwartungen herunterzuschrauben, auf die Patienten, seine Nöte und Bedürfnisse einzugehen.“
Begriff Lebensqualität bekommt eine neue Bedeutung
„Wichtig ist, sich mit dem Ist-Zustand zu arrangieren und danach auszurichten, wie es weiter geht“, erklärt Dr. Martin Fuchs, Chefarzt für Innere Medizin und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Palliativmedizin bei nicht onkologischen Patienten der DGP. „In diesem Szenario findet eine Verschiebung der eigenen Werte, der eigenen Definition von Sinnhaftigkeit statt – der Begriff Lebensqualität bekommt eine neue Bedeutung.“
Die im Juni gegründete Landesarbeitsgemeinschaft Palliativversorgung Hessen (LAPH) veranstaltet in jährlichem Rhythmus Palliativtage innerhalb des Landes. Nach der Auftaktveranstaltung im osthessischen Fulda wird ein zweiter Kongress am 8. März 2008 das Thema „Umgang mit dem eigenen Sterben“ beleuchten.
Die LAPH möchte die Rahmenbedingungen in der Palliativversorgung durch eine enge Vernetzung aller engagierten Kräfte weiter voran zu bringen. Darüber hinaus geht es auch darum die Interessen der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) auf Landesebene zu vertreten und deren Mitglieder aller Berufsgruppen zu vertreten. Schwerpunkte setzt die Arbeitsgemeinschaft in der Aufklärungs- und Informationsarbeit sowie der Aus- und Weiterbildung in der Palliativversorgung und ganz besonders in der Qualitätssicherung.